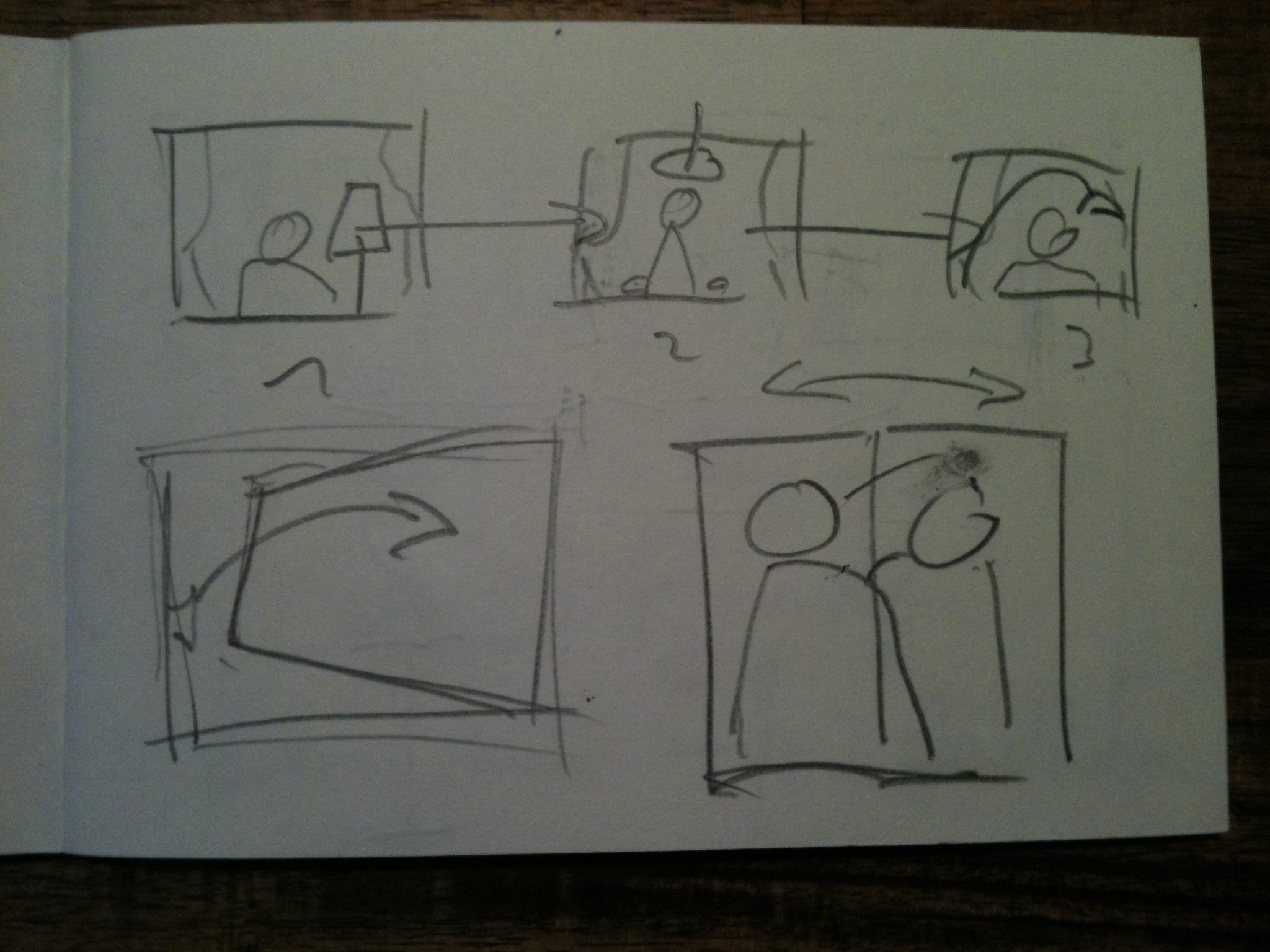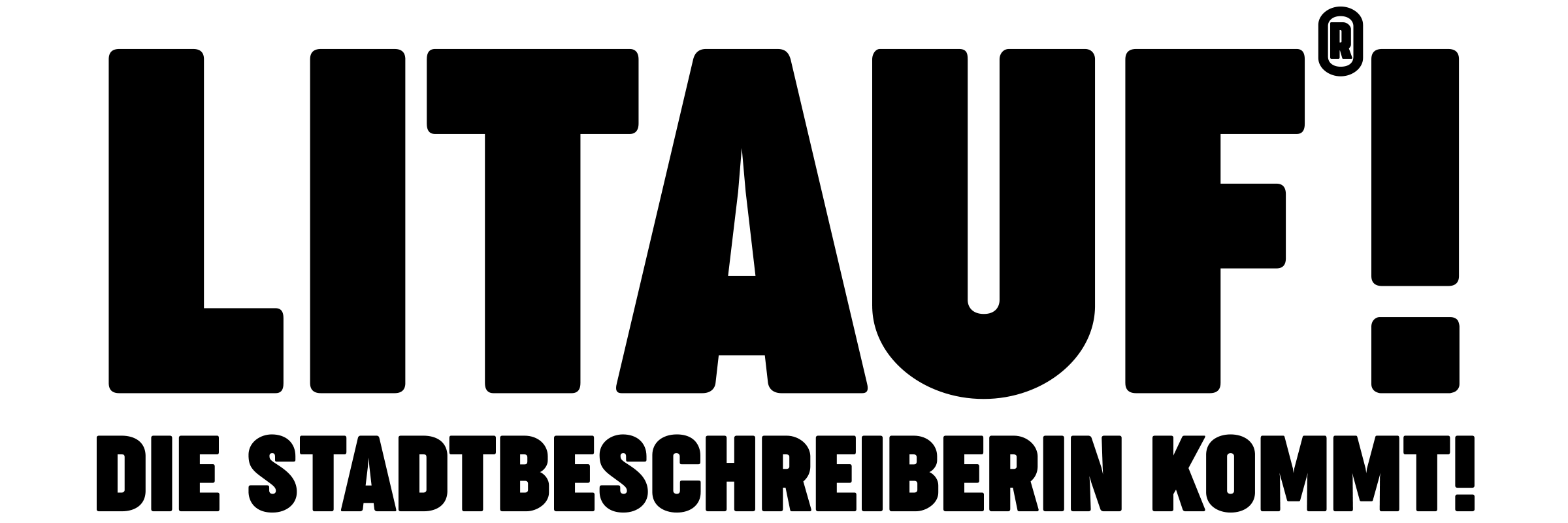“Oktober 1942 legte das Schiff weit von Shanghai entfernt an. Von Bord ging die Frau des Arztes ohne ihren Mann. Ein junger Passagier hielt sie am Arm fest, bevor sie aussteigen konnte. Die letzten fünfzehn Tage hatten sie im Nebel verbracht.” Clemens liest laut. Es ist, als sähe sie ihn das erste Mal ganz, während er für sie liest. Fast auf einem Ton, neugierig und vorsichtig und behutsam mit jedem Wort, tastet er sich mit der Stimme an. Er findet den Ton, weil er sucht.
Beide liegen sie in die gelbe Lichtlache der Leselampe getaucht. Clemens blättert um und biegt das Buch gewaltsam auseinander, bis der Einband leise knackt.
„Mann, Vorsicht. Buchrücken sind Engelsrücken.“
“Aber das mach ich doch mit dir auch so.” Er grinst. Clemens muß als Kind ein zufriedener bunter Holzklotz gewesen sein. Solche Klötze hat es in Fedes Generation noch nicht gegeben. Oder sie hat nicht mit solchen gespielt.
„Lies weiter.”
„An einem heißen Januartag gegen Ende des Monats drehte der Wind.“
“Du liest nie laut?” fragt Fede.
„Ich lese nie.”
„Gefällt es dir trotzdem?“
„Wenn es dir gefällt, meine Süße.“ Er versucht sie zu küssen.
“Lies weiter.” Sie sieht andächtig zur Zimmerdecke.
„Nachdem er still gebetet hatte, sah er eine Reisende eintreten, durchnäßt wie eine Schiffbrüchige und von den Kindern bestaunt.”
Er liest, und sie lernen sich noch einmal kennen.
Noch einmal wirft Clemens an ihrem ersten Schützenfestabend im Mai sein Feuerzeug in den Gulli vor ihrem Haus und fragt: Hast du da oben Feuer? Noch einmal sagt er Anfang Juni: Du hast 98 Punkte, und sie schweigt. Ja, nur 98 Punkte, denn du bist nicht richtig blond und du kannst nicht Skifahren, außerdem bist du jetzt dafür zu alt. Noch einmal ist es Oktober, und sie murmelt in seinem Arm im Halbschlaf: Der Baum da, ganz gelb. Und noch einmal fängt an dem Tag mit der Herbstkälte etwas Neues an zwischen ihnen, aber anders als damals. Nicht diese unverbindliche Vertrautheit, sondern eine Zukunft und eine Verschworenheit. Noch einmal geht er an jenem Morgen mit Hemd aus der Hose zur Tür hinaus, wie im Sommer, und sagt, ohne sich nach ihr umzudrehen: Jetzt hast du 99 Punkte. Er meint es ernst.
Clemens klappt das Buch zu. Aus Wendischs Geschichte ist seine geworden, und Fede strahlt ihn an.
Eine Woche später. Clemens kommt gegen sechs. Es ist schon dunkel, und beim Coop verkaufen sie die ersten Weihnachtsbäume.
Wenn es klingelt, schaltet Fede seit einer Woche gleich das Deckenlicht aus und die Lampe neben dem Bett an. Sie liegen eine Zeit ineinander verschlungen, lieben sich oder lieben sich noch nicht, bis sie sagt: Los, lies. Sie schlägt das Buch an der Stelle auf, wo sie Wendischs Geschichte am Tag zuvor verlassen haben und denkt an etwas anderes dabei. Daran, was nach dem Lesen kommen wird, und daran, daß nachher sie an den Moment jetzt denken wird. Oder daran, daß sie auch in diesem Jahr keinen Baum kaufen wird. So sitzen drei Momente auf einem und machen das Leben weniger schlimm. Später dann schlafen sie ein, er zuerst, und sie schaut im Dunkeln manchmal überrascht zum ihm hinüber, nicht wie früher wegen seiner Schönheit, denn die hat längst die Nacht verschluckt. Sie schaut ihn an und würde gern hinter seine geschlossenen Lider sehen. Dann schließt sie selber die Augen und erinnert sich. Als sie als Kind zum ersten Mal mit der Mutter in der Metro von Paris war und sie beide bei der Bastille einstiegen, in die Linie, die bis zur Endstation unterirdisch fährt, da hat sie, Fede, sich gleich in den Zug gedrängt, hat diese junge Mutter vom Land am Rock als erste mit durch die schmatzende Tür gezogen, kaum daß die offen war, und hat gerufen: Mama, Mama, schnell, damit wir einen Fensterplatz bekommen.
Fede öffnet die Augen. Jetzt ist es im Zimmer dreifach dunkel, wenn man die Dunkelheit von Flur und Bad mitzählt. Sie tastet nach Clemens´ Hand, und er, im Schlaf, erwidert den Druck ihrer Finger. Ja.
5.
Und noch eine Woche später hat es richtig angefangen zu schneien. Die älteren Frauen im Dorf haben längst ihre Kopftücher unter dem Kinn fester gebunden. Magere Flocken, fast noch Tropfen, fallen senkrecht unter der Straßenlaterne auf den Asphalt. Sie steht am geöffneten Fenster. Der Straßenlärm läßt nach, wie immer bei Schnee, wie immer am Abend. Als ob die Stadt, als ob die Welt sich vom Haus entferne. Nur die Geräusche der Nachbarn rücken näher, die Vorabendserie im dritten, der Dauerschnupfen im fünften, das Baby, das zahnt, im ersten Stock. Am Straßenrand hält der dunkelblaue Peugot. Als seine Fahrertür sich öffnet, hört sie diese Musik, die sie nicht mag. Dann das Geräusch der Autoantenne, die hineingefahren wird. Sie schließt das Fenster. Das dünne Tuch Schnee unter ihrem Fenster bleibt unberührt. Clemens fährt nie auf den Anwohnerparkplatz.
Er steht in der Tür, in seinem dunklen Vertreteranzug und lockert den Krawattenknoten. Ich muß gegen zehn noch mal weg, sagt er, lächelte dabei und schließt die Lider. Wieder ihr Wunsch, dahinter zu sehen. Wieder der Wunsch, dort zu sehen, was sie sich wünscht. Sie stellt sich vor, er küsse sie in die Beuge am Hals, und sie ließe die Knie auseinanderfallen, er küsse ihre Schläfe und sie lächele, er küsse ihren Puls, und sie öffne die Fäuste. Sie schließt die Etagentür, nimmt seine Hand und führt sie von der Gürtelschnalle abwärts über den Reißverschluß seiner Hose. Er sagt nichts, aber sein Gesicht. Sie zieht den Gürtel mit einem Ruck aus den Schlaufen und läßt ihn am ausgestreckten Arm baumeln. Das hier, sagt sie laut, ist eine Verhaftung. So sind die Frauen, widerspricht ihr Lächeln, wenn der Wind einmal weht, weht er durch jede Ritze. Ach, lesen wir heute Abend nicht? Er ist erstaunt, dann schaut er auf den Gürtel. Los, ausziehen, sagt sie. Er schaut sie an, ohne mit den Wimpern zu zucken. Sie faßt sich ins Gesicht. Es ist anders geworden? Ein kleiner gelber Winterapfel? Die Haut sitzt nicht mehr fest auf dem Fleisch? Ob man sich verbraucht, ob man neu wird bei der Liebe? Zieh dich aus, sagt sie, und er und sie sitzen noch einmal im Auto, auf dem Parkplatz, vor der Oper Straßburg, wie neulich. Er knöpft im Stehen das Hemd auf, wie immer von unten nach oben, und fragt, warum. Es gibt keinen Grund, es ist nur näher, sagt sie. Das Hemd fällt auf die Schwelle. Los, und sie stößt ihn gegen den Türrahmen, erst mit den Händen, dann mit ihrem ganzen Körper. Dann lehnt sie sich wieder zurück an den Pfosten ihm gegenüber. Das ist ihr Spiel. Sie treiben sich gegenseitig in die Hitze und versichern sich danach der Kälte. Plötzlich aber ist Fede nicht mehr sicher, ob das bei ihm ebenso gilt, und vielleicht nur, um wieder sicher zu sein, was gilt, stellt sie sich vor: Eines Sonnabends, mittags, in fünf oder sechs Jahren kommen sie mit ihren Rädern vom Wochenmarkt und sind mittlerweile zu dritt. Clemens, sie, und auf ihrem Gepäckträger das Kind. Ein Junge, fünf, und mit einer Sonnenblume in der Hand. Und an diesem Samstagmittag, als das Kind mit der freien Hand versucht, bei Coop in den Kleiderständer mit den Sonderangebote zu fassen, und die neue Verkäuferin zufällig in die Tür gelehnt steht, raucht und lächelt und beides sehr langsam tut, an eben diesem Mittag in fünf oder sechs Jahren, da schiebt Fede ihr Rad mit dem Kind nah an die andere Frau heran, damit sie dem Jungen über den Kopf streichen, und ”schönes Kind, schöne Blume, schönes Wochenende” sagen kann, während die rote Markise ein sanftes rosa Licht auf die Szene wirft. Und in diesem Licht, oder vielleicht auch wegen dieses Lichts, fragt Fede leise die andere Frau, was sie denn koste. Was sie denn koste, die Frau. Dabei dreht sie sich zu Clemens um, der an diesem Tag Geburtstag hat. Der Blick der Verkäuferin streift erst das Kind, dann Fede, dann den, der Geburtstag hat. Ihre Wimpern sind lang, bis zu ihm hinüber. Und da ist ein seltsames Geräusch, das Fede als Mädchen schon kannte, aber über das sie nie gesprochen hat.
Das Geräusch zwischen den Beinen von einem Mann.
Fede öffnet die Augen. Clemens steht nackt am Türpfosten gegenüber. Einer von ihnen wird bald schon zum Kühlschrank gehen, fragen, was willst du trinken, als sei nichts geschehen. Sie sind knapp einen Meter voneinander entfernt. Der Abstand ist für jede Phantasie groß genug.
Auf der Digitalanzeige ihres Radioweckers ist es halb zehn, als er sein Hemd wieder zu knöpft. Was tust du? Mich wieder anziehen. Du gehst? Ja, ins Kino. Jetzt noch, und in welchen Film überhaupt? In den, in den du mit mir nicht gehen willst, weil dir das Plakat nicht gefällt. Mit wem gehst du denn? Die Frage kommt kläglicher als sie gewollt hat. Mit einer Bekannten.
Mathilde?
Richtig, Mathilde.
Gruß an den Papagei! Fede verstellt die Stimme zur Papageienstimme.
Während er unten den Schlüssel in die Wagentür steckt, öffnet sie oben das Fenster. Er gehe aber auch in jeden Film, der ein großes Plakat habe! klingt es zu fröhlich auf die stille Straße hinunter. Er lacht, legt den Kopf in den Nacken, küßt zwei Fingerspitzen und schlägt sie in ihre Richtung aus. Ein Taxi fährt vorbei und verschluckt fast seine Antwort. Komme gegen eins zurück, darf ich?
Ob er dann schon gegessen habe?
Er zeigt ihr einen Vogel.
Dann ist die Straße leer. Niemand mehr da, nicht mal mehr einer, der langsam vorbei geht. Was wird Clemens jetzt tun. Und was wird er dann tun? Und was wird dann sein? Sie, Fede, wird nichts tun, aber das mit Haltung. Was wird der Papagei tun, wenn Clemens bei Mathilde zur Tür hereinkommt? Geht-ihr-jetzt-vögeln-los-geht-vögeln, wird er krächzen? Was wird Mathilde tun? Das Tuch nehmen und es über den Käfig werfen? Und dann? Die beiden?
So ist das. Erst ist man traurig, dann einsam, dann allein, dann schaltet man den Fernseher ein. Fede drückt auf die Fernbedienung. Jemand mit Wiesen und Pusteblumen im Hintergrund empfiehlt ihr, das Deo zu wechseln. Sie haßt Pusteblumen, die haben immer so etwas Befruchtendes. Sie nimmt ein Bad. Als sie das Unterhemd auszieht, ist da ein dürres Geräusch von Stoff auf Haut. Sie legt sich in die Wanne, das Wasser reicht bis zum Kinn, der Schaum knistert in kleinen ebenmäßigen Hügeln vor ihrer Nase. Ja. solange es ein Bad gibt, lohnt es sich zu leben. Sie löst sich im warmen Wasser langsam auf. Im Fernsehen wird es später einen alten Film mit Romy Schneider geben, sie wird erst eine halbe Falsche Wein dazu trinken und dann die andere Hälfte auch noch, und wird, wenn sie sich eine Zigarette anzündet, meinen, sie habe das Gesicht von Romy Schneider.
Später, als Mitternacht bereits vorbei und sie fast eingeschlafen ist, hört sie, wie irgendwo im Haus sich sanft eine Tür öffnet, hört sie Pantoffeln im Flur, hört den Aufzug surren, und dann die Pantoffeln auf einem Korridor, der zu ihr führt. Sie steht auf, um Wasser zu trinken und hebt beiläufig den Gürtel von der Türschwelle auf und geht danach schnell ins Bett zurück. Regen fällt da draußen auf den Schnee und wäscht vielleicht bis morgen die Welt ganz fort. Sie schläft ein und hat mehrere kurze böse Träume. Um Viertel vor zwei klingelt es. Sie dreht sich um, merkt, ihr Nacken ist starr vom Warten. Bloß nicht aufstehen und hingehen, sonst erfüllt sich ein Alptraum, den sie seit langem schon hat. Vor der Tür steht nichts als Schwarz. Nur Schwarz. Nicht einmal Nacht. Nicht einmal niemand. Jetzt öffnen? Nein, denn dann dringt die schwarze unversöhnliche Einsamkeit des Sternenhimmels ins Apartment ein. Noch einmal hat es geklingelt. Sie schleicht sich zum Fenster und sieht, daß da ein Taxi steht auf der anderen Straßenseite. Der Motor läuft, aber weder der Fahrer noch ein Gast sind zu sehen. Sie geht leise in die Küche und setzt Teewasser auf, den Kessel füllt sie bis zum Rand, obwohl sie soviel Wasser für sich allein gar nicht braucht. Als sie zum Fenster zurückkommt, fährt das Taxi gerade fort, und sie glaubt, vier Schlußlichter zu sehen. Noch immer macht sie kein Licht im Zimmer, öffnet aber das Fenster, holt eine Wolldecke, die rote, die frisch nach Weichspüler riecht, und setzt sich auf die Fensterbank. Sie schaut in die Nacht hinaus. Auf der einen Seite, links, ist der Horizont heller, ein lichter Streif. Auf der anderen Seite ist es finster. Sie schaut in die Nacht hinaus, bis die Dunkelheit ihr auf die Augen drückt und sie, in die Wolldecke gehüllt, auf der Fensterbank einschläft. Auf dem Weg in den Schlaf begegnet sie einer Frau mit langem, sehr glattem, aschblondem Haar bis zum Hintern, die sie endlich fragen kann. Wo geht es denn hier zum Kino? Unter den langen Haaren trägt die Frau eine Polizeiuniform. Zum Kino? Die Frau streckt einen ebenfalls sehr langen Arm aus. Immer geradeaus, bis zur nächsten Kreuzung, dann rechts, und dann den Baum hoch.
Da pfeift der Wasserkessel, und Fede fällt. Sie fällt aus dem Traum heraus hinunter auf die Straße, sechs Stockwerke tief, und denkt im ersten Moment: Scheiße, schon wieder aus dem Bett gefallen. Aber sie fällt noch immer. So lange dauert das doch sonst nicht, daß sie dabei drei Gedanken haben kann. Ich falle wirklich, nein, aus dem Bett, nein, jetzt wird es ernst, ich falle auf den Anwohnerparkplatz direkt unter meinem Fenster. Ich falle so schnell, daß mein Schutzengel mir nicht folgen kann.
Die Frau bin ich.
Der Wasserkessels pfeift, da oben im sechsten Stock auf ihrem Herd, pfeift so laut aus dem geöffneten Fenster in die kalte Winternacht hinein, daß wegen des Lärms nach und nach kleine häßliche gelbe Quadrate überall im Haus aufflackern, über ihr.