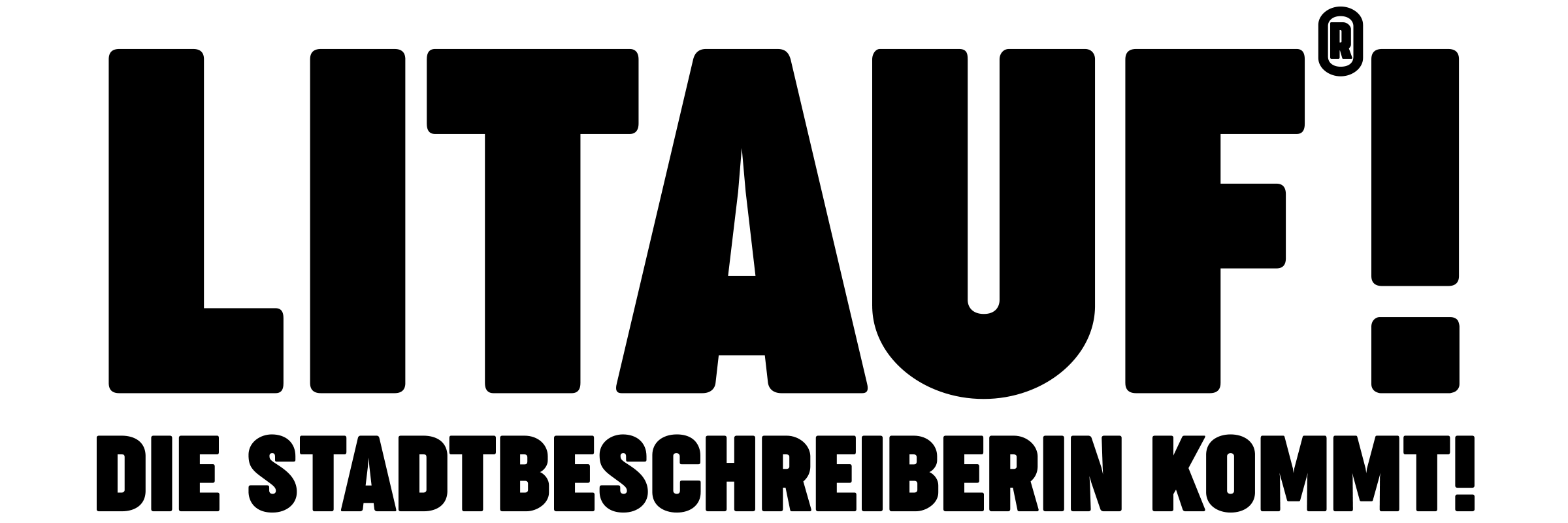Sein Wagen parkt direkt vor dem Schuleingang. Zwei Angestellte vom Rathaus stellen ihre Räder an einem Baum ab, obwohl es Fahrradständer im Hof gibt, die grauen für die Stadt, die grünen für die Schule. Mathilde und Clemens sprechen nicht miteinander. Sie lächeln ihr entgegen. Er hat ein anderes Gesicht, blaß, und unter der Blässe fester als gestern noch.
„Wir haben auf dich gewartet”, sagt Clemens. Mathilde nickt.
Wir!
Der Platz neben ihm ist besetzt, und sie hat zu lange in der Erinnerung mit Wendisch auf einer anderen Kühlerhaube herumgesessen. Im Abschied. Auf einem Ford Transit, silbergrau, der längst abgefahren ist. Die Aussicht von dort, vom Abschied, beim südlichen Bahnübergang, ist immer beschissen gewesen. Man sieht von dort aus, wo Wendisch sie vor fünfzehn Jahren hat stehen lassen, das düstere geduckte Bahnwärterhäuschen, in dem ab nachmittags eine häßliche Deckenlampe brennt, unter der die Familie beim Kartenspiel und die Großmutter vor dem Fernseher hocken, und hinter dem Bahnwärterhäuschen sieht man auf die Sümpfe beim Fluß. Warum hat sie an einen einzigen Satz von Wendisch ihre Zukunft gehängt: Wir werden eines Tages auf der Schwelle eines alten Hauses hier in Sesenheim mit den Nasen gegeneinander stoßen. Darauf hat sie gewartet. Wie albern. Spätestens als er sagte, er wisse sogar, was er an diesem Tag des Wiedersehens tragen würde, etwas Hechtgraues nämlich, hätte sie auf einen anderen Stuhl im Leben rücken müssen. Wie schnell es doch geht, daß man zu langsam ist. Mit dem Mittelfinger sucht sie das Haar am Kinn, diese schwarze Borste, die alle drei Tage nachwächst. Sie sieht Clemens dabei an. Es wird noch ein wenig dauern, aber sie hat schon verloren, und wenn man älter wird, ist jede Niederlage eine Demütigung. Sie sucht mit dem Finger am Kinn herum und macht so ein blödes Gesicht.
„Habt ihr euch schon geküßt?“ Sie wirft einen prüfenden Blick auf die falsch abgestellten Fahrräder dabei und bildet sich ein, da stünden zwei Kartons, auf beiden der Buchstabe W für Wendisch. Zwei Kartons, in denen nichts mehr ist. Eine schwarze Krähe landet auf dem Mülleimer neben den falsch abgestellten Fahrrädern und dreht den Kopf, als solle man sie von allen Seiten zeichnen.
“Wie bitte?” Clemens rutscht von der Kühlerhaube. Er zündet sich eine Zigarette an, schiebt den Kiefer vor, so daß die Zigarette wieder in diesem gewissen Winkel von seinem Gesicht absteht. Der gewisse Winkel, wie ein gewisses Lächeln. Ein sehr männliches Kind, das breitbeinig ihr Leben betreten hat, das nachts so leise atmet wie alte Männer laut schnarchen, und das sie plötzlich doch liebt, weil sie bemerkt, kein Teil seines Körpers ist ihr lieber als sein Gesicht? Sie hätte sich früher bei der Liebe erwischen sollen! Clemens steht nun dicht vor ihr und legt die Hand an ihren Hals. Er schaut auf ihre Taille, den Hosenbund, und gleich wird er wieder sagen: So eine Jeans kann man nicht ohne Gürtel tragen, Fede. Aber er legt nur die Hand an ihren Hals, die Hand, die im nächsten Jahr um diese Zeit sich nicht mehr auf sie legen wird. Zu Neujahr werden sie sich noch einmal schreiben, und eines Tages wird alles vergessen sein.
Irgendwo läßt ein Auto den Motor an, fährt aber nicht weg. Und sie beide, eine Doppelfigur und aus der Achse geraten, kippen noch nicht, sondern halten. Ein schmaler Grat, der Kuß. Sein Handgelenk ist nah an ihrem Ohr. So hört sie seine Armbanduhr ticken, und als sie einmal kurz die Augen öffnet, sieht sie auf seiner linken Schulter die kleine Mathilde hocken, obwohl sie beim Auto steht. Sie hockt da wie ein zutraulicher Vogel. Eine optische Täuschung zwar, aber beängstigend, wie sie, die Züge entspannt, sich an etwas wärmt beim Warten, als habe sie die ganze Zeit über einen Fleck Morgensonne im Gesicht, an so einem trüben Tag wie heute. Heute gilt wohl für sie nicht. Sie sieht blind und groß und ruhig aus, die kleine Mathilde, und Fede hört sie hinter den dünnen geschlossenen Lidern da drüben den Satz von damals wiederholen: Ich habe Sie schon oft gesehen, Sie fahren doch unter der Woche nach Straßburg in einem blauen Peugot. Sie fahren manchmal an mir vorbei.
In dem Moment fährt das Auto mit dem laufenden Motor fort.
„Was macht der Papagei, Mathilde, dein Linkskraller?“ Fede schiebt Clemens ein Stück von sich fort und fragt munter, um die Stille, die zwischen ihnen entsteht könnte, zu vertreiben. Die Krähe hat einen Rest Bratwurst aus dem Müll gezogen und fliegt auf. Hoch über der Krähe fliegt ein Flugzeug. Sesenheim liegt in der Einflugschneise von Straßburg, und in den letzten Jahren stehen immer mehr Häuser leer.
“Der Papagei ist mir weggeflogen, vorgestern”, sagt Mathilde leise. “Ich lebe jetzt allein. Daran muß man sich erst einmal gewöhnen.”
In Straßburg sei er schon fünfzehn Jahre nicht mehr gewesen, sagt der Hausmeister. Seitdem er ohne Auto sei. Ob sie denn einen schönen Abend gehabt habe? Sie nickt. Ja. Straßburg ist für manche ein ganzes Leben von Sesenheim entfernt.
Fede steht im Schulflur, und hinter den Türen murmelt es. Es riecht nach alten Äpfeln, Putzmittel, lauwarmer Milch und Weichspüler. Monsieur Berger geht. Dafür kommt die Sonne. Ein paar weiße Strahlen dringen durch die dünne Wolkendecke, dann durch die ungeputzten Oberlichter der Flurfenster, nun in Bündeln, und bescheinen die Kleiderhaken auf Kindshöhe. Zwei Haken fehlen. Zwei dicke Nägel ersetzen sie, von Monsieur Berger persönlich in den bröckelnden Putz eingeschlagen. Auf dem rotbraunen PVC führen acht hellere Trampelpfade zu den acht Klassenzimmer und irgend etwas, vielleicht der Handspiegel einer dieser kleinen Sekretärinnen drüben im Rathaus, blendet Fede, als sie dort so ratlos steht. Als die Hauskatze ihr um die Beine geht, bückt sie sich: “Laß dich bloß nicht sterilisieren, denn das mit der Liebe geschieht nicht dauernd, man muß schon nehmen, was man kriegt”, sagt sie, “ja, und so ein Kater, das sind mindestens drei Kätzchen, also wenigstens was fürs Herz.”
Da schlägt der Schulgong am Ende der ersten Stunde. Sie kneift die Katze ins Genick und richtet sich auf, steht mit Jeans und ohne Gürtel mitten im Gang, während die Kinder um sie herumlaufen und zu laut grüßen. Sechste Stunde Sport, denkt sie, geht in ihr Klassenzimmer, öffnet die Fenster. Die letzten Blätter sind endlich von den Bäumen gefallen und kleben auf dem nassen Straßenpflaster.
Wo Clemens´ Auto gestanden hat, ist ein heller Fleck auf dem regennassen Asphalt.
Er habe geträumt, er habe plötzlich das Gesicht von Robert Mitchum, und das sei schweißnaß, während eine Frau, deren Gesicht er gar nicht erkennen könne …
Die Hand am Hörer, räumt sie mit der anderen das feuchte Sportzeug aus der Schultasche. Typ Traumfrau also, sagt sie. Draußen wird es dunkel. Clemens hat ihren Einwurf nicht gehört und redet schon weiter.
… eine Frau also, die ihn anstarre, und wie er auch Whisky trinke. Er habe nämlich, er als Robert Mitchum, unterhalb des Herzens einen Steckschuß. Und einen im Bein. Was? Das sei nicht so schlimm? Man müsse nur liegenbleiben, bis einer käme? Aber das könne im Traum dauern …
“Aber da ist doch noch die Frau”, sagt Fede.
Er sei dann, sagt Clemens, ohne Robert Mitchum im Bett aufgewacht, so gegen sechs, sei ins Bad gegangen, und habe angefangen, sich zu rasieren. Irgendwann sei ihm klar geworden, daß es nicht schäumte.
“Zahnpasta”, sagt er. “Ich habe aus versehen Zahnpasta genommen.”
Sie lacht, und das ist es, was er will. Denn noch in ihr Lachen hinein fragt er.
„Kann ich jetzt kommen?“
Fede fährt mit dem Blick die Wandregale in ihrem Zimmer entlang. Alles Bücher. Einmal, als sie einer Freundin eine Aufnahme von sich und dem neuen Apartment geschickt hat, hat die zurückgeschrieben: Gut siehst Du aus. Aber in welcher Bibliothek ist das denn aufgenommen?
“Fede?”
“Komm”, sagte sie.
Ich kaufe ab jetzt Weichspüler und er bleibt, denkt sie und starrt an die Decke. Nach sieben Jahren, an einem sonnigen Novembernachmittag werde ich sagen, siehst du, nun sind wir schon sieben Jahre zusammen. Siehst du, wir haben gelernt, glücklich zu sein. Clemens wird nicken. Dann wird er mich küssen und gehen.
Fede dreht sich auf den Bauch. Clemens liegt neben ihr.
Er hat sie vor einer halben Stunde mit einem Griff in den Nacken auf das Bett geworfen, so wie man kleine dünne Mädchen im Schwimmbad zurück ins Wasser wirft, bis sie lachen. Aber Fedes Begeisterung hat etwas gefehlt, ihrem Lächeln auch. Er hat ihren Hals, ihre Brust, ihr Haar gebissen, und sie hat dabei an etwas anderes gedacht. Möge er doch für den Rest seines Lebens all die Frauen, die nach ihr kommen, danach abtasten, ob und wo sie ihr ähnlich sein könnten, damit er in ihnen zwar die Welt, aber nicht sie, Fede, vergessen kann. Bist du jetzt glücklich, werden die anderen Frauen fragen müssen, und er wird in dem Moment bemerken, daß er traurig ist. Wegen Fede. Der Dorfschullehrerin von damals, großer, schmaler Mund und blau-graue Augen, ein breites aber feines, herzförmiges Gesicht, und ein Zug von Kummer um den Mund, der eigentlich genau Fede ist.
“Was denkst du?” Clemens steht auf, stellt sich lässig ans Fenster öffnet es, ohne Sorge, daß etwas an seinem Körper nicht stimmen könnte, und er sich deshalb vielleicht anders drehen sollte. Er lehnt sich hinaus.
“Was denkst du?”
Was für Fragen der plötzlich stellen kann.
Er lehnt sich noch weiter hinaus, so daß auch alle Nachbarn ihn sehen und sich vorstellen können, wer hinter ihm im Bett liegt.
“Die haben ja den Rasen da unten zubetoniert”, sagt er und schnippt seine Zigarette hinaus. “Ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Sieht ja beschissen aus.”
“Ja.” Sie greift an das Kopfende vom Bett und knipst die Leselampe an.
„Komm her.”
Er dreht sich um. Sie hat das Buch von Wendisch in der Hand.
“Lies”, sagt sie. “Lies mir vor.”