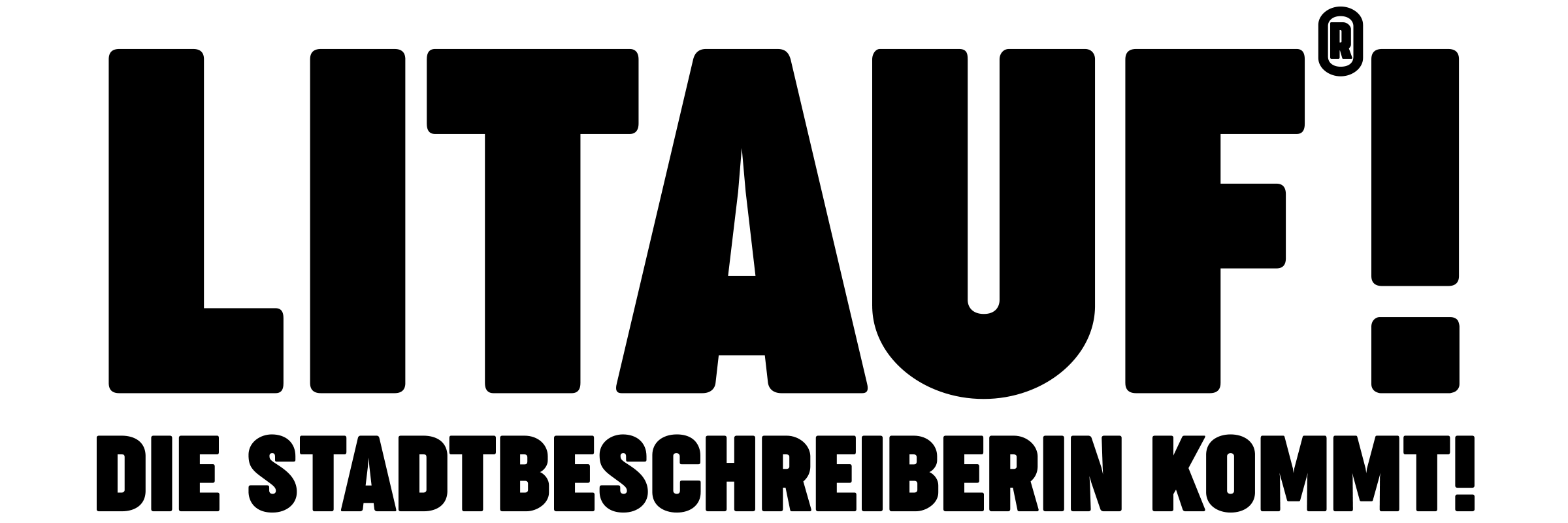Kurz vor eins. Sie gehen über die Akazienallee, die Oper im Rücken. Der Hund trottet neben Wendisch her, die Nase am Boden. In einem Auto zwischen zwei blauen Parkstreifen ziehen ein Mann und eine Frau sich hastig um. Wendischs Schulter stößt bisweilen gegen ihre, wenn die Schritte aus dem Takt kommen. Sie hat Wendisch größer in Erinnerung. Ein Regen, den sie im Café nicht bemerkt haben, muß in den vergangenen zwei Stunden die letzten Spuren vom Schnee weg gewaschen haben. Jetzt liegt der Papagei am Ortseingang Bischwiller direkt auf dem Asphalt. Mathilde hat auch so einen Papagei. Der frißt morgens ohne weiteres ein Stück butterbestrichenes Knäckebrot. Ein Linkskraller, sagt Mathilde stolz, wenn sie ihn Gästen vorstellt. Sie ist siebzehn. Fede ist achtunddreißig. Sie ist froh, wenn sie davonkommt mit den alltäglichen Dingen, die sie tut. Wenn sie Kinder in einer Schule im Seitenflügel des Rathauses unterrichten kann, solange es Kinder gibt. Oder wenn sie Eisverkäuferinnen an der Ecke Eis verkaufen sehen kann, wenn die Sonne scheint, solange es Eis und Ecken gibt, und die Sonne scheint.
Wendisch versucht den Arm um ihre Schulter zu legen.
„Warst du immer so groß?“
„Ja.“
„Hatte ich vergessen.“
Sie stoßen auf die erste Querstraße, wo der Fluß Ille die Stadt Straßburg zu einer Stadt am Fluß macht. Nur das Polizeipräsidium ist noch erleuchtet. Davor steht ein einzelner Mann mit kurzem Haar und Uniform und raucht.
„Haben Sie auch die Sternschnuppen heute Nacht gesehen?“ fragt er streng.
Sie nickt und zieht ihren Rockbund zurecht.
„Ja, Herr Kommissar.” Sie geht schneller danach.
Sie biegen in die Rue des Enfantsein. Wendisch zieht einen Autoschlüssel aus der Manteltasche, und der Hund schaut ihn bestürzt an. Vielleicht fährt er nicht gern Auto.
“Welche Sternschnuppen?” fragt Wendisch.
„Die Leoniden”, sagt Fede, “wo warst denn du heute Nacht gegen elf, als man die Leoniden noch sehen konnte?”
Wendisch sagt, er weiß es gar nicht mehr, verbessert sich und ruft, als gäbe es einen Grund zu rufen: „Die Lesung, alles klar doch. Ich war wohl beim Signieren!“
„Aber ich war dabei.” Sie erzählt von einem freien Feld, von einem Feuerwerk, von einem Wir. Das Wir wird in ihrem Mund zu einem zärtlichen Tier.
„Da hast du ja richtig was erlebt.” Fede nickt und sieht in einem blanken dunklen Fenster, Parterre, ein aufgestelltes Bügeleisen mit abgekühltem Gesicht zur Straße schauen.
„Wo gehen wir eigentlich hin?“
„Wir gehen einfach so lang, wie das Leben. Wie die Liebe.”
„Und wie geht die Liebe? Wie geht die, was meinst du?“
„Vorwärts, rückwärts, seitwärts … Schluß. So geht die Liebe”, sagt sie.
„Schade.”
“Wieso?”
“Ja, schade”, sagt er. “Sonst hätte ich dir vorgeschlagen, wir könnten uns, wenn ich in der Gegend bin, alle paar Wochen sehen, auf einen Tag und eine Nacht. Können wir nicht?”
Sie bleiben auf einer Brücke stehen. Der Hund drückt die Schnauze durch das Geländer und wedelt mit dem Schwanz. Er grüßt wohl einen Fisch. Fede stemmt sich mit beiden Händen an der Brüstung hoch, verliert den Boden unter den Füßen. Ihre durchgestreckten Arme zittern. Als sie sich vor Anstrengung kaum noch halten kann, kann sie es endlich sagen.
“Nein”, sagt sie, “du hast so grauenhaft vorgelesen.“
Sie wünscht sich, es käme ein Regen, und das Schweigen, das von diesem Rauschen ausginge, verbreitete sich über die Stadt. Die Dächer naßglänzend, und sie unter einem davon, gegen eine fremde gebügelte Bettwäsche gedrückt, und auf ihr liegt ein Unterarm, ziemlich behaart, der Mann am Arm schläft, sagt etwas oder etwas nicht im Traum, um dann die Augen aufzuschlagen, sie anzusehen. Nur die Menschen sehen sich bei der Liebe an. Tiere nie. Der Mann nimmt sie bei den Hüften und setzt sie auf sich. Es ist Clemens.
„Sieh mich an”, sagt Wendisch
„Kann ich machen”, sagt sie. „Aber mit Liebe ist da nichts.“
„Was war so schlimm an meinem Vorlesen?“
„Deine Schauspielerei”, sagt sie. „Deine Stimme war nicht einfach und machte kein Licht. Ich habe den Ton des Buches nicht gehört, weil du so laut warst. So ein Buch ist still, stelle ich mir vor. Du hast aus dem Auftritt des Buches deinen Auftritt gemacht. Du glaubtest, du seiest souverän und elegant, aber für mich hast du nur nachgemacht, was ein Künstler ist. Das war alles recht unterhaltsam, und deine Zuhörer haben dich gemocht. Du bist auf eine intelligente Weise interessant. Glückwunsch. Du hast aber dein Buch an die Wand gespielt, und deine Zuhörer haben die Verve bewundert, die deine Stimme bei dem Kraftakt hat. Ich würde dein Lesen Lärm nennen.“
„Trotzdem bist du zurückgekommen, um ein Buch zu kaufen. Was willst du damit heute Nacht.“
Jetzt, wo er fragt, fällt ihr ein, was sie will.
„Fahr mich zum Bahnhof”, sagt sie. “Sofort!”
Bei “sofort” läuft der Hund los, ein wenig schräg und die dunkle Straße entlang.
„Warte”, hat Wendisch beim Auto gesagt und etwas aufgeschrieben, das Blatt geknickt, klein, kleiner und ihr in den Ausschnitt geschoben. Dahin, wo Clemens sie manchmal küßt. Es war seine Adresse.
“Der Bahnhof ist gleich dort”, hat er gesagt, “hinter der Einbahnstraße. Du bist schneller zu Fuß da.”
Er hat die Beifahrertür für den Hund aufgeschlossen, sich hinter das Steuer gesetzt und dann erst auf die Frontscheibe gestarrt. Ein Handschuh hat unter dem Scheibenwischer geklemmt. Fede hat ihn gleich gesehen, er erst, als er die Zündung und dann die Scheibenwischer angestellt hatte.
“Schau mal, da winkt dir eine”, hat sie gesagt und in dem Moment gewußt: Ich habe mich entliebt, längst schon, und in den letzten drei Stunden endgültig. Ich werde nach Sesenheim zurückfahren, mit dem ersten Zug am Morgen und noch vor Schulbeginn beim Elternhaus das Gartentor ölen.
“Ich gehe jetzt”, hat sie gesagt.
„So eifersüchtig”, hat Wendisch gesagt und eine Braue hochgezogen, hat den Oberkörper halb aus dem Auto gehoben, um den Handschuh unter dem Wischer wegzuziehen.
“So eifersüchtig, wegen eines Handschuhs? Ist doch ganz originell, von ihr, oder?”
“Ja, sagt sie, “aber den Hund unter den Wischer zu klemmen, wäre noch origineller gewesen.”
Wendisch hat zu gut ausgesehen als er durch die Seitenscheibe noch einmal zu ihr hoch sah, und sie ist sehr rasch gegangen, bevor ihr Herz oder ihr Fleisch sie hätten überlisten können. Sie hat seinen Blick, eine letzte Versuchung, im Rücken gespürt und deutlicher deswegen die Kontur ihres Körpers unter dem Mantel, als sei sie nackt.
Natürlich hat sie sich da gewünscht, er würde den albernen Handschuh dieser albernen Person und den albernen Hund dazu an der nächsten Ecke aus dem Auto werfen. Er würde sich diese letzte alberne Mühe machen, für sie, und hinter ihr herlaufen. Sie hat sich nicht umgedreht.
… es war die Nacht vom 17. auf den 18. November. Die Nacht der Leoniden. Wir fuhren gegen Mitternacht auf ein freies Feld hinaus, um die kleinen Sterne stürzen zu sehen. Wir.
Nach wenigen Schritten ist der Satz fertig. Das schreibt er sich jetzt so auf. Wieder so ein Satz von ihr, auf dem er dann schreibt. Da ist sie sicher. Das ist es, was bleibt von der Nacht, in der er an der richtigen Stelle nicht dabei war. Das ist es, was ihn am Leben hält. Nicht dabei sein, aber trotzdem das Richtige schreiben. In dem Moment dachte sie einen richtigen Satz, und als er fertig war, war er verschwunden. Wendisch wäre das nicht passiert.
Während sie über den leeren Bahnhofsvorplatz ging, die katzenäugigen Leuchtstreben auf dem Boden als Weg meidend, während die wasserdichten Schuhe nach einem langen Tag drückten, während die Leuchtschriften der Hotels vis a vis der nächtlichen Bahnhofsfassade in rot und gelb und blau andere Städte, andere Frauennamen vorschlugen, Nizza, Stella, Bordighera, während sie auf die Eingangshalle zu ging, groß und schmal, von der Nacht zu einer wunderbaren Erscheinung hochgezogen, glaubte sie allerdings, die Welt in ihrem Rücken sehe ihr zu und stehe ihr bei. Sie drehte sich doch noch einmal um und ging rückwärts.
So sah sie nicht das Taxi, gegen das sie lief. Es war leer.
4.
Einen Moment lang überlegt sie, ob sie im Stella oder Bordighera ein Zimmer nehmen soll. Dann wischt sie einer weißen Bank über die Sitzfläche, setzt sich, mit dem Rücken zur Glasfront des Bahnhofs, zu den Hotels, zur Stadt, zu diesem Abend. Sie schließt die Augen, hört die Neonleuchten über ihrem Kopf summen und summt mit. In der Bahnhofshalle Straßburg streift sie die bösen Schuhe von den Füßen und versucht, im Schutz der modernen Glasarchitektur einzuschlafen. Vier Uhr siebenundfünfzig fährt der erste Zug Richtung Sesenheim. Über Fede auf der Bank flattert eine einzelne Taube unter dem Glasdach und findet keinen Weg hinaus. Schlaf doch, sagt sie zu der Taube und schläft selbst ein. Es ist kurz vor halb fünf, als sie das nächste Mal aufwacht. Aus dem Nachtzug Marseille-Paris-Berlin kommen ein paar müde Reisende, denen man ansieht, sie haben eben noch die Hände im Haar gehabt, haben eben noch mit leisen Stimmen im abgedunkelten Abteil geredet, ein Pfefferminz oder Kaugummi in den Mund gesteckt, und abwechselnd auf ihre Armbanduhren geschaut, als verginge so die Zeit schneller. Auch sie schaut auf die Uhr. Clemens´ Uhr. Noch immer stechen der große und der kleine Zeiger in den roten Stern. Sie dreht die Uhr auf und stellt sie nach. Sehr geschickt, ihr eine Uhr zu schenken. So muß sie immer an ihn denken, immer wenn sie hinschaut.
Kurz vor fünf. Nichts würde sich so früh morgens in einem Vorortzug mit schmutzigen Scheiben, Richtung Sesenheim, klären lassen. Sie schaut über flache öde Landschaft, die dem Rhein und den Reihern gehört und freut sich auf zu Hause. Die Flammkuchenfabrik wird beim Bahnübergang die Nachtschicht ausspucken, ihr Zug wird dort vorbeifahren und nur sie wird hinausschauen. Am Abend kurz vor sieben werden wie immer die Glocken läuten, erst die evangelischen, dann, zur Antwort, die katholischen, die aber tiefer. Sie werden den anderen im Dorf den Himmel bestätigen, und ihr, obwohl sie nicht glaubt, ein Zuhause sein. Sie wird freitags jede geleerte Mülltonne vom Haus an ihrem hohlen Klang wiedererkennen und auch, wer sie von der Straße zurück in den Keller zerrt, ob der Besitzer des Fahrradgeschäftes oder die Nachbarin aus dem dritten Stock, die immer so hemmungslos singt, als sei das ganze Haus eine Badewanne, oder der Junggeselle aus dem vierten Obergeschoß, links, der am Wochenende im ganzen Treppenhaus diesen Geruch nach billigem Rasierwasser verbreitet. Sie wird bald wieder am Fenster sitzen und jede Fahrradklingel von weitem erkennen.
„Und Sie waren in Straßburg?“ Der Mann im Zug ihr gegenüber schaut sie schon die ganze Zeit an. Auch er riecht nach Rasierwasser.
“Bildhauerin, Schauspielerin, Töpferin?”
“Nein, Lehrerin.”
“Ach so eine. Sehen Sie”, sagt er da, „heute Morgen waren es vier Grad unter Null. Aber das Wasser hat vergessen zu gefrieren. Ich habe in die Pfütze vor meinem Auto geschaut, dann in die Regentonne, dann in den Trinknapf für die Meisen. Kein Eis. Nicht mal ein Glanz von Kälte. Ich habe gedacht, ich werde verrückt. Dann bin ich ins Haus zurückgegangen und dachte, wo ist meine Frau. Einen Augenblick habe ich geglaubt, ich hätte sie gestern abend an der Tankstelle bei Hagenau vergessen. Aber nein, nein, sie war ja tot. Das hatte ich vergessen und da habe ich mich weiter erinnert. Ich hatte sie nie geliebt, und in dem Moment habe ich mich auch an das Wasser draußen erinnert, den Winter. Das Eis.” Er klopft gegen die Zugfensterscheibe.
„Sehen Sie? So ist dann alles gefroren.“
Fede drückt die Stirn gegen die Scheibe. Sie legt das Gesicht in die Hände. Ihr Gesicht ist sehr schwer.
“Ist Ihnen nicht wohl?”
“Doch, doch.” Sein Rasierwasser in der Nase, schaut sie auf, streift seinen Blick und sieht wieder aus dem Fenster.
Der Morgen draußen hat ein graues Kleid an, das er sich nicht ausziehen läßt.
Vor dem Bahnhof Sesenheim steht ein einzelnes Taxi. Den Fahrer kennt sie seit immer. Vom 19. November bis zum 8. März trägt er in jedem Winter eine russische Pelzmütze. Den roten Stern, sein drittes Auge im Fell, hat er ihr vor über zwanzig Jahren einmal geschenkt. Da war sie vielleicht siebzehn. Er hebt zum Gruß zwei Finger zur Stirn.
„Du warst in Straßburg?“
„Ja.“
„Streunerin”, sagt er.
Sie geht weiter und sieht sich von außen. Ein großes müdes Pferd mit einer Laufmasche, links. Ja, sie kommt von Straßburg nach Sesenheim zurück. Von S. nach S. Sie ist also nicht sehr weit gekommen. Vor dem Coop stößt die Frau des Pächters mit dem Fuß Obstkisten in die Kälte. Äpfel, Bananen, sogar Mangos. Die Ärmsten. Die Kälte drückt von außen gegen die Ladenfenster und innen brennt ein eiserner Ofen gleich hinter der Tür. Auf dem Ofenrohr steht in Rot und von Hand geschrieben Dominique. Das hat schon immer da gestanden, und so hat sich nie jemand gefragt, wer eigentlich Dominique gewesen sein mag.
Fede biegt in die Straße ein, in der sie früher gewohnt hat, als ihre Eltern noch lebten. Ein leichter Regen setzt ein. Dann Wind. Der Wind wird stärker. Beim Haus des Pfarrers schlägt im ersten Stock unsanft eine Fensterhälfte zu. Jemand schaut zu ihr herunter, während er die zweite von innen schließt. Das Gesicht hinter dem Glas ist ein großer grauer Fleck und vom Schlaf noch gedunsen. Sie läuft Richtung Ortsausgang. Vor dem Apartmenthaus, in dem sie wohnt, nimmt eine Betonwalze gerade ihre letzte Kurve. Sie haben es also doch getan, haben den Rasenstreifen betoniert, um numerierte Parkplätze für die Anwohner zu schaffen.
Sie nimmt den Aufzug in den sechsten Stock, schließt ihre Wohnung auf, betritt ihr Schließfach, wie sie es nennt, und streift gleich bei der Tür die regendichten Schuhe ab, legt das Buch von Wendisch auf die Heizung im Flur und wirft einen Blick in den Wohnraum. Die Teerosen auf der Tapete kommen ihr vollzählig vor. Sie schaut ins Bad. In dem Spiegel über dem Waschbecken prüft sie ihr Gesicht, malt unentschlossen mit einem weißen und einem roten Stift an der Müdigkeit herum. Sie denkt an eine Tasse Tee und eine Brioche im Stehen, und daran, diesen blöden Klodeckel zu schließen, der seit gestern Abend offen steht, als Clemens sie für Straßburg abgeholt hat und als letzter zum Klo gewesen ist. Sie nimmt das Telefon und wählt seine Nummer. Keiner geht ran.
Sie geht zurück ins Bad und wirft den Klodeckel zu.
Bis zu Schule braucht sie nur wenige Minuten. Das Schulhaus steht als Quergebäude zum Rathaus, verlängert vom Turnhallenpavillon, wo die Mädchen die unteren Fensterscheiben mit Packpapier verklebt haben, wegen der Jungen, die aber trotzdem am Nachmittag feixend mit ihren Mofas dort herumstehen. Von weitem sieht sie die Schulhofbänke aus Stein mit aufgeklebtem Badezimmermosaik, dem nach jedem Winter mehr Steinchen fehlen, vor allem rote, und neben der Bank liegt dieser Haufen Tannengrün, mit dem der Hausmeister Monsieur Berger etwas Weihnachtliches vor hat, seit Ende Oktober schon. Drei Steinstufen führen zum Schulflur hinauf, die Tür geht so schwer, daß die Kinder sie kaum öffnen können. Aber in Japan sind die Türen an den Schulen noch viel schlimmer, sagt Fede den Kindern immer. Da werden die, die zu spät kommen, von einem Gitter zerquetscht, das Punkt acht heruntergelassen wird. Oft droht sie ihren Kindern mit Japan. Das hält sie ruhiger, wenigstens bis nach dem Wochenende.
Der Montag, einer von vielen, einer wie immer. Vielleicht läuft sie ein wenig schneller als sonst, denn der Wind ist eine große Hand in ihrem Rücken. Doch dann bleibt sie plötzlich stehen.
Auf der Kühlerhaube des blauen Peugeots sitzen Clemens und Mathilde.