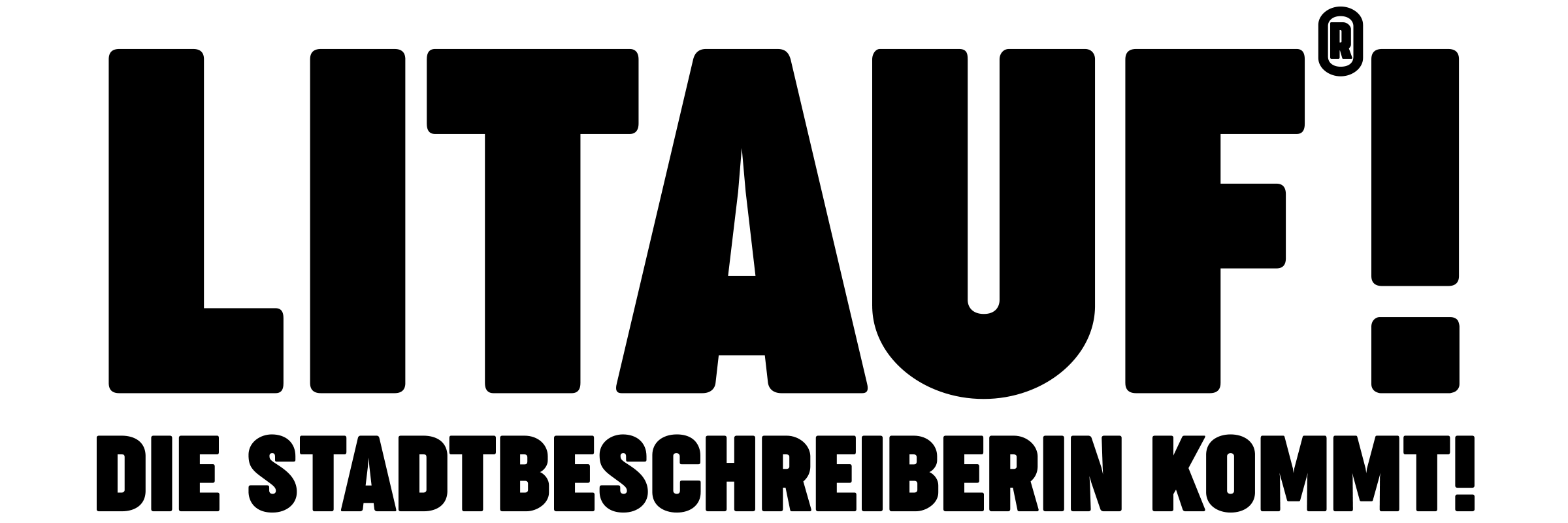Wendisch hat sie nur einmal im Fernsehen wiedergesehen, in einer Veranstaltung für Sieger. Der erste geladene Gast war Tennisspieler, der zweite Modekönig und der dritte, Wendisch, ist als ein Sieger in Sachen Liebe und Literatur zur Talkshow am Freitagabend geladen gewesen. Sie hat ihm zulächeln müssen, obwohl er ihr nur vom Fernseher aus in die Augen sah. Dieses gewisse Lächeln ist in den Jahren seit seinem Abschied fest in ihrem Gesicht geblieben, zu einem Zug geworden, unbestimmt, angenehm. Sie ist hübsch geblieben mit der Erinnerung an ihn. Das Alter hat gezögert, sie anzugreifen, als befürchte es, Ärger zu bekommen, mit Wendisch, falls der noch mal, in Hechtgrau, nach Sesenheim zurückkommt, um auf der Schwelle vom Coop mit ihr zusammenzustoßen.
Ich wollte doch immer einmal zurückkommen, hört sie ihn in diesen schönen Momenten der Einbildung dann sagen.
Und wie?
In einem hechtgrauen Anzug.
Hechtgrau meinst du, das reicht als Zeichen der Reue?
Sie, auf der Schwelle des Coops, bemerkt dann, er sucht nach festen Sätzen im hilflosen Schweigen.
Ach, ich habe von uns erzählt.
In deinen Büchern?
Ja, aber mach dir keine Sorgen. Was ich von uns erzähle, darin ist kein Strich, der nicht erlebt wurde, aber auch kein Strich ist darin so, wie er erlebt wurde.
Wendisch hat in der Talkshow tatsächlich einen hechtgrauen Anzug getragen. Hechtgrau ist in dem Jahr seit Jahren aus der Mode gewesen. So hat sie sich gegen Ende der Sendung sogar die Nägel feilen und, ohne noch einmal aufzuschauen zu müssen, sich einreden können, sie warte nur auf den späten Spielfilm.
„Wir sind gleich da.“ Der Taxifahrer streicht mit seiner Rechten über den Beifahrersitz. In dem Geräusch, das seine Hand macht, steckt eine Frage.
Sie sucht nach dem Geldbeutel in ihrer Handtasche. Er fährt langsam und schaltet das Autoradio ein. You have lost that loving feeling, singt Elvis Presley. Sie lacht, weil sie am Hals merkt, sie ist rot geworden.
Auf die Oper zu führt eine Doppelreihe mit Akazien, dazwischen liegt eine Promenade für Spaziergänger. Die Stämme der Akazien haben sich geschält schon vor dem Winter, und die Rinden liegen, ein Schmerz, auf dem Weg aus feinem Kies. Sie überholen eine Gruppe von jungen Menschen, die alle schwarz gekleidet sind. Von den Fenstern der Oper sind nur zwei, Parterre rechts, erleuchtet. Dort ist das Operncafé. Dort muß Wendisch noch sein.
Ich warte, hat Clemens vor vier Stunden auf dem Parkplatz neben der Oper gesagt, die Krawatte im Auto abgebunden und den obersten Knopf an seinem Hemd geöffnet. Mach weiter, hätte sie in dem Moment gern gesagt, dann bleibe ich hier. Mit großen Schritten, die jung aussehen sollten, hat sie dann doch den Parkplatz hinter sich gelassen und ist auf die Oper zugelaufen. Im Rücken die Augen des einen, in den eigenen Augen bereits die Augen des anderen Mannes.
„Haben Sie eigentlich einen Freund?“ Der Taxifahrer schaut sie an.
„Wieso?“
„Soll ich warten?” Er zieht die Handbremse an.
3.
Vier Kronleuchter, rote Stofftapete und zwei junge hübsche Kellner, die vielleicht die Aufnahmeprüfung zu staatlichen Schauspielschule nicht geschafft haben und vielleicht deswegen so eingebildet sind. Mit einem Blick in die Glastür hat Fede das Haar gerichtet. Salon Sophie, Sesenheim. Auf den schwarzgoldenen Fensterbänken stehen Topfblumen und Perückenköpfe. Die Wände sind mit schweren Stoffen und Masken drapiert, und die Espressomaschine lärmt. Sie hat eine ganze Provinz an den Fersen, als sie quer durch den Raum muß. Alle schauen sie an, nur der, den sie kennt, schaut nicht. Der kriecht unter dem Tisch herum. Eine blonde Frau beobachtet die Unterseite seiner Schuhe dabei. Beide tragen sie bereits Mantel.
Na, geht ihr jetzt vögeln, würde Fede am liebsten quer durch den Raum bis zu dem hintersten Tisch da drüben fragen, auf dem das Schild “Reserviert”steht.
Fede öffnet wieder den obersten Knopf ihres Mantels. Daß man zusammen schläft, ist weder unerhört, noch schicksalhaft, denkt sie. Eine Erregung bekommt man auch beim Holzfällen. Ein Stöhnen ist kein Versprechen. Und daß es einen zum Schreien bringt, sich so nah zu sein, sagt eigentlich auch nichts. Man reicht etwas hinüber, was man nicht Liebe nennt. Das kennt sie. Fede öffnet den zweiten Knopf am Mantel und geht einen Schritt vor. Nur ist es nicht schön, denkt sie, daß man schutzlos den Vorstellungen ausgeliefert ist, der andere mache es mit einer anderen genauso, und sehe dabei genau so aus. Niemand ist gemeint in dem Moment, von dem sie immer glaubte, er könne sich nur zwischen ihm und ihr so anfühlen. Niemand ist gemeint in dem Moment, von dem sie als Mädchen immer dachte, daß er einen Mann und eine Frau für immer aneinander binde oder für immer voneinander entfernt.
„Also“, sagt sie laut und geht vor, bis sie mit der Hüfte gegen die Tischkante stößt. Der Tisch ruckt. Sie stößt ihn noch einmal an. Eine Störung, die gut tut. In diesem Augenblick flackert über dem Tisch im Operncafé ein Musikvideo auf, und das Schild “Reserviert” fällt um. Hinter dem Tisch öffnet ein großer Spiegel das Fenster zu einem zweiten Raum, in dem es alles nicht und doch noch einmal gibt. Fede sieht, dort drüben rückt Fede den Tisch weiter vor.
„Was soll das?“ Die Redakteurin spricht Deutsch.
„Tischerücken. Alter elsässischer Brauch hier.”
„Und was soll dabei herauskommen?“
„Die Wahrheit”, sagt Fede.
Da streckt Wendisch endlich seinen Kopf unter dem Tisch hervor.
Er hat den falschen, leeren, den dumpfen Ausdruck eines Mannes auf dem Gesicht, dem eine Frau soeben versprochen hat, daß er in einer halben Stunde befriedigt sein wird, wenn er mitkommt.
„Er sucht meinen Handschuh”, sagt die Redakteurin, “wir wollten gerade gehen.“
Fede dreht sich ratlos einmal auf der Stelle.
„Bleib doch”, sagt Wendisch da, und als Fede die Hand auf den Tisch legt, langt sie in einen klebrigen Rest Alkohol.
Dann ist sie erst einmal durch das Foyer hinauf ins Erste Parkett gelaufen. Denn das Café hat keine eigene Toilette. Sind alle Wände rot bespannt und die Treppen rot ausgelegt gewesen? Oder ist es nur das Schweinwerferlicht gewesen? Sie weiß es nicht mehr. Neben der Herrentoilette hat sie einen Mann mit dunklen Bartstoppeln telefonieren sehen, hinter vorgehaltener Hand. Seine Augen sind grausam und starr gewesen, als sie gezögert hat, um zu lauschen. Er hat zu sprechen aufgehört, bis sie die Toilettentür hinter sich geschlossen hat. Wiederhole, was ich dir gesagt habe, hat sie ihn noch sagen hören. Und in der Nase hat sie den Geruch gehabt, den seine Spucke wohl auf der Sprechmuschel gelassen haben mag. Im Spiegel hat sie ihre Haut gesehen, Schale im Winter. Sie hat einen Kaugummi in den Mund gesteckt und Vorsätze gefaßt. Sie wird sich eine Suppe mit Wein bestellen, sie wird diesen unklaren Zustand lächelnd ertragen, sie wird am Kaugummi weiter kauen, das sie gegen einen Wunsch, zu küssen, eingetauscht hat. Sie wird sagen, doch, doch, ich gehe gleich, und sich noch einmal zurücklehnen, wird den Kopf ihres Daumens in der Hand halten, gegen den schweren Augenblick. Sie wird die andere nicht wegbeißen, nur absitzen.
Als sie zurückkommt, sitzt Wendisch mit dem Rücken zu ihr, am Tisch, im Mantel, allein. Sie sieht, wie er eine lachsfarbene Visitenkarte in seine Brieftasche steckt, bleibt leise stehen, sagt aber laut: “Mensch, Wendisch, du Aas.”
So etwas hat sie noch nie getan und Wendisch schrickt zusammen. Auch wenn sie nicht mehr schön sein sollte, nach all den Jahren und um diese Nachtzeit, hat sie ihm doch noch was zu sagen. Sie hat seinen Blick bemerkt, im Spiegel hinter dem Tisch. Alles schon Bild, auch wie sie dasteht, klein, nicht mehr jung, mutig. Anmutig. Seine Gedanken sind schneller und schärfer als seine Beobachtungen. Wäre sie nackt, er würde seufzen und gleich wissen: eine Nymphe wie bei Soundso, so durchsichtig, wie gemalt, so transparent.
In dem Moment wird das Licht dunkler, und jemand sagt: Minuit.
„Komm.“
Sie bleibt stehen.
„Komm”, sagt Wendisch und zieht dabei wieder seinen Mantel aus. Sie ihren auch. Sie kommt. Auf dem Bildschirm über seinem Tisch wiederholt sich stumm das Musikvideo. “Der Chor des Theaters Weimar” blendet der Untertitel ein. Der Chor singt, einmal in Weimar bei Sonne, einmal in Weimar bei Schnee. Im Winter ist der Atem sichtbar, aber man hört trotzdem nichts. Sie spielt mit dem Schild „Reserviert“ und hat sich noch nicht gesetzt.
“Ich habe dich übrigens im Fernsehen gesehen.” Plötzlich hat sie das Lächeln, das sie all die Jahre konserviert hat für ihn, verloren. Hat ein ganz kleines, böses Gesicht. Eine Faust mit zwei funkelnden, harten, blaugrünen Steinen darin. Sie stellt sich vor, sie kratzt ihm den Arm, die Brust auf, und etwas, das brennt, gerät in die Wunde. Sperma?
„Erzähl.“ Er greift nach ihrem Handgelenk. Die Geste soll die Zärtlichkeit haben, die seiner Stimme fehlt.
„Ich bin mit dem Taxi gekommen”, sagt sie und setzt sich endlich.
Es ist eine russische Armbanduhr, auf die sie jetzt schaut. Sie hat sie von Clemens, und woher der sie hat, weiß sie nicht. Nachdem er sie zwei Mal unter ihren Bett vergessen hatte, hat er sie ihr geschenkt. An der Position Zwölf leuchtet ein roter Stern. Clemens ist ein Gedanke, den sie im Moment ausdrücklich nicht denken will.
„Ich wollte dein Buch von dir kaufen”, sagt sie zu laut.
„Das hättest du vor zwei Stunden gekonnt.“
„Da wollte ich aber noch nicht.“
„Aber jetzt sind keine mehr da, die Buchhandlung ist längst fort. Ich könnte dir eins schicken.“
Sie legt ihren Handschuh auf das einzige Buch, das auf dem Tisch liegt.
„Das ist mein Leseexemplar, mit Strichen.“
„Mit Strichen”, fragt sie und legt ihre Hand auf den Handschuh.
„Fede”, sagt er.
„Fede”, sagt sie.
„Hübsche Fede.”
„Hipsch Fede”, sagt sie, wie die Leute im Dorf es sagen. Dann Schweigen. Sie schweigt kürzer.
„Genau”, sagt sie da. „Das will ich.“
„Fede”, er zögert und schaut sich um. Nach den anderen Menschen im Café? Nach einer Zigarette.
„Rauchst du noch?“ Ihre Hand auf dem Handschuh ist heiß.
„Fede”, sagt er, und legt seine Hand auf ihre. „Bist du krank?“
„Fede, bist du krank? Bist du im Schrank”, sagt sie mit verstellter Stimme, mit Genugtuung. So endete ein Gedicht, das er vor fünfzehn Jahren für sie geschrieben hatte.
Sie sitzen da, beide entschlossen zur Kälte. Sie beobachten sich. Vielleicht ist ja einer von ihnen heil geblieben in all den Jahren, um das Spiel neu zu beginnen, nur weil ein Wunsch, wer weiß denn welcher, noch im geheimen Herzen blieb? Wendisch bestellt, was sie will, Suppe und Wein. Der Kellner flirtet mit ihr. Danach fühlt sie sich tatsächlich hübscher. Sie nimmt zum Essen den Kaugummi aus dem Mund.
„Hast du ein Papier?“
Er schüttelt den Kopf.
„Dann gib mir die Visitenkarte.“
Er lächelt, zieht seine Brieftasche aus der Hosentasche und holt daraus eine Karte.
„Nicht die”, sagt sie, “die lachsfarbene.“
Er lächelt nicht mehr. Sie wartet.
„Mit jeder anderen Frau schläfst du dich weiter von mir weg”, sagt sie, “gib mir also wenigstens ihre Karte.“
Er gehorcht, dann zuckt er zusammen.
„Scheiße, was tust du da“, sagt er. Sie wickelt ihren Kaugummi in den lachsfarbenen Karton.
„Voilà Viola”, sagt sie, ohne genau gelesen zu haben. „Welch ein Name. Viola Mortimer, Fax und Fon und alles dran.“ Sie zielt genau, und das zerdrückte Papier landet hart im Aschenbecher.
„Sag mal, hast du schon was getrunken?“ fragt er.
„Sag mal, hast du schon was gegessen?“
Der Kellner bringt eine Packung Zigaretten und schaut sich Wendisch genauer an. Ob er ihn zu alt für sie findet? Aber aus dem Alter, daß ein Mann zu alt für sie ist, ist sie langsam heraus.
„Hat dir mein Buch gefallen?“ fragt Wendisch.
„Würde ich es sonst mitten in der Nacht per Taxi kaufen kommen?“
„Aber das hättest du doch wirklich einfacher haben können Warum hast du nach der Lesung nicht gewartet?“
„Weil jemand auf mich gewartet hat, draußen“, sagt sie.
„Ach”, und Wendischs Gesicht rutscht aus der Fassung, was sie freut. In seiner Vorstellung muß sie wohl die letzten fünfzehn Jahre in einem Einmachglas gesessen haben, bei verschlossenem Deckel, der Boden mit Kunstrasen ausgelegt, und auf dem chemiegrünen Rasen steht ein kleiner Wohnwagen, aber mit dem kann sie nicht weg. Mit dem fährt sie nur ab und zu gegen schützendes bruchsicheres Glas, bis ihr der Nacken weh tut. Dann fährt sie wieder zur Mitte zurück und setzt Teewasser auf.
„Warum hast du mir nie geschrieben?“
„Aber”, und er sieht genau zwischen ihre Augen, “aber habe ich doch.“
„Aber nur eine Karte mit Pfingstrosen. Auf der stand, daß es so nicht mehr geht, weil deine Frau meine Haare in deinen Socken gefunden hat.“
„Deine verdammten Haare”, sagt er da zärtlich und greift wieder nach ihr. Sie weicht aus und wischt mit dem Finger ihre Lippenstiftspur vom Glas.
„Warum hat dir mein Buch gefallen?“
„Wegen der Bilder.“
„Ach Gott, ja, das nun wieder”, sagt er müde. “Und welche?“
„Die von der Liebe. Die, in denen ich glaubte vorzukommen, und jene, in denen ich gern vorkäme.“
„Liebe, was soll denn das sein”, fragt er.
Sie läßt den Löffel in der Suppe stehen und sieht ihn so ernst an, daß er lachen muß und sie, in das Lachen hinein, das Wort „Liebe” wiederholen könnte, ohne daß er es merkt. Dem Leben mehr entreißen, als es zu geben vermag, das ist Liebe, denkt sie. Das ist Liebe für mich. Sie zittert wenig, aber spürbar, und das kommt ihr erbärmlich vor. Er zündet ein Streichholz an, betrachtet die Frau am Nachbartisch, Mitte Vierzig, lange silberne Ohrgehänge, kurze rote Haare, irgendwie östlich, rumänisch, mit einem dicken blauen Buch aus der Leihbibliothek. Auch wenn er jetzt das Streichholz wieder ausbläst und seine alte Fede anlächelt, sie kennt das schon. Ab jetzt wird er immer wieder zum Nachbartisch schauen und ans Wildern denken.
„Was war das nur mit uns?“ Sie nimmt ihm das angekokelte Streichholz aus der Hand und bröselt das Schwarze vom Kopf, und in dem Moment klingelt in seiner Manteltasche das Telefon. Geh doch dran, will sie sagen, doch sie sieht die Veränderung in seinem Blick. Um diese Zeit kann das nur eine Frau sein. Seine Frau.? Die von früher? Oder eine neue, eine noch neuere? Wenn er jetzt nicht ans Telefon geht, gefällt diese Frau ihm nicht mehr richtig, und Fede, oder die Erinnerung an die Fede von früher gefällt ihm besser. Schon greift er Fedes Hand, greift höher, bis zum Ellenbogen ist er schon bei ihr, und diese andere Frau steht sehr allein im Nachthemd, in einem fernen kalten Flur beim Telefon, oder liegt mit angezogenen Knien in einem halbleeren Bett und beginnt aus den Haaren oder zwischen den Brüsten zu riechen, weil er nicht abnimmt.
Fede aber leckt am Suppenlöffel.
„Hast du ein Kind?” Das Telefon klingelt noch immer.
„Ja.“
Sie schaut in den Spiegel hinter dem Tisch. Plötzlich hat sie das Gesicht, das sie in zehn Jahren einmal haben wird. Müde und hart. Um wenige Millimeter verschoben, weg vom Schönsein. Nach diesem Abend wird sie endgültig ausgeschieden sein und den Platz am Fenster einnehmen, wo die Alten in Sesenheim sitzen. Das Leben wird vorübergehen, und sie wird zwei Kissen auf die Fensterbank und zwei Unterarme auf zwei Kissen legen. Sie wird ihr Leben betrachten, wie man einen langweiligen Regentag betrachtet. Vielleicht findet Wendisch für ihre Regentage einen Platz in seinem Buch, wenn er etwas Atmosphärisches braucht? So wäre der Unsinn, den sie lebt, nicht vergeblich. Aber Wendisch schüttelt nur den Kopf. Er will sich nicht wie sie erinnern? Oder will er nur nicht ans Telefon gehen?
Der Kellner neigt sich in dem Moment, wo das Klingeln aufhört, über den Tisch und sagt auf Französisch, das Benutzen von Handys sei in diesem Lokal untersagt, und in dem Moment hört das Klingeln auf. Mit einer letzten Bestellung geht er zum Tresen zurück. Er wackelt ein wenig mit dem Kopf dabei.
Es dauert, bevor sie sich ansehen und weiter sprechen können.
„Wie lebt es sich jetzt in Sesenheim?” fragt Wendisch ungeschickt.
Wieder klingelt das Telefon, Wendisch holt es heraus und kriecht mit einem kleinen „Ja?“ hinein.
Den Oberkörper halb unter dem Tisch, gibt er sich Mühe, seine Lustlosigkeit sachlich klingen zu lassen. „Ich sitze hier noch mit den Engländern, Jaja, genau, mit dem Verleger und dem Übersetzer. Es kann spät werden. Küß den kleinen Frosch von mir.“ Er steckt das Handy weg.
„Wie alt ist denn der Frosch?“
„Fünf.” Er blickt nicht auf. „Ich weiß, eine späte Sünde.“
In diesem Augenblick mag sie Wendisch überhaupt nicht mehr. Wünscht sich fort. Wünscht sich, Clemens warte auf sie am Bahnhof Sesenheim, wenn sie mit dem letzten Zug doch noch dort ankäme. Clemens, in seinem flaschengrünen Pullover, den er ihr manchmal leiht, nimmt sie unter den linken Arm. Für einen Moment wohnt sie in seiner Achselhöhle. Er schiebt sie ins Auto, ins Zimmer, ins Bett und schläft an sie gedrängt gleich ein. Am Morgen wachen sie auf, wie sie eingeschlafen sind.
„Wie alt ist denn die Mutter vom Frosch?“ fragt sie.
„Achtundzwanzig.”
Fede schaut auf ihre Uhr. Beide Zeiger stechen in die Mitte des Sterns. Aber es ist längst nach Mitternacht.
„Ich mag dein Glück nicht”, sagt sie.
Die zwei hübschen Kellner fahren das Licht weiter herunter und drehen die Musik lauter. „New York, New York“ ist der Rausschmeißer. Als das Lied zum zweiten Mal läuft, tritt die Redakteurin hinter Wendisch. Ein nasser Irish Setter, der zu ihr gehört, kriecht mit aufgerichtetem Hinterteil unter den Tisch. „Dora, Dora“, sagt die Redakteurin zweimal zärtlich zum Hund. Beide Frauen schauen sich an. Die Redakteurin drückt dabei ihre Haarspitzen wie Teebeutel aus und setzt sich auf die Stuhlkante. Dann schaut sie in den Aschenbecher, auf das Stück geknüllte lachsfarbene Pappe. Einen Moment lang ist ihr Gesicht lang und töricht.
„Ich bin gekommen, um zu sagen, daß ich jetzt gehe”, sagt sie.
„Wir wollten auch gerade gehen“, sagt Fede.
„Wo sind Sie eigentlich her?“ Die Redakteurin schaut auf Fedes Haar. Salon Sophie, Sesenheim. Klar sind Fedes Haare nur Haar und keine Frisur.
„Sesenheim”, sagt sie. “Ich komme aus Sesenheim.”
“Ach, ja? Das kennt man ja aus der Literatur.”
“Stimmt, da haben wir uns kennen gelernt.”
Fede schaut Wendisch an, und an der Bar lacht die Rothaarige aus Rumänien laut auf und sagt: “Und dann ist es quietschend durch den See gepaddelt und hat sich am Ufer zwischen die Nackten gelegt, das Schwein.”
Die Redakteurin gähnt und schaut nach dem Hund unter dem Tisch. Er stinkt.
Sesenheim, weißt du noch, sagt Fede jetzt mit den Augen zu Wendisch. Das Croix d´Or, weißt du doch noch?
Wenn jemand den Windfang betrat und noch nicht die Tür aufgestoßen hatte, dann strich sich bereits die zukünftige Frau vom Organisten die weiße Schürze glatt. Gäste! rief sie dann schüchtern, und als sie das bei dir das erste Mal rief,weißt-du-noch, war sie noch sehr jung. Du fragtest beim Essen nach dem Weg nach Fraize. Nach Fraize, wiederholte da die zukünftige Frau vom Organisten, und es klang verliebt, wie sie Fraize sagte. Sie erklärte gern den Weg dorthin, der soundso führte, und malte mit einer Messerspitze auf das weiße Tischtuch dabei, gleich neben deinem Teller. Da habe sie nach der Schule bei Renault gearbeitet, sagte sie. Den Weg im Tischtuch strich erst ein nächster Gast am nächsten Tag glatt. Der aß, was du wohl nicht mehr weißt, ein Pferdesteak mit zuviel Zwiebeln und fragte, warum in den Fensterbildern unserer Kirche die Reihenfolge in den Legenden nicht stimme. Warum Kain und Abel auf einem Feld, das zu gelb sei, sich schlügen, noch bevor Adam und Eva, ihre Eltern, aus dem Paradies vertrieben worden seien. Gen Osten, ins Land Noth. Und, fragte der Fremde, wessen Idee das frivole Blau auf der Empore gewesen sei. Barock, nicht frivol, sagte unser Pastor, der zufällig am Nachbartisch saß. Kehler heißt er, weißt du noch? Der stand schwer auf, stützte die Hände auf die nächste Stuhlkante, dann auf eine nächste, eine nächste, und kam so langsam herüber und dem, der da so fragte, näher und setzte sich zu dem Fremden dazu. Zur Welt.
Fede hat eine Hand auf Wendischs Unterarm gelegt. Er hat die ganze Zeit über ihren Augen sehr ernst zugehört. Ihre Hand liegt auf Wendisch und sagt: Meiner!
“Sesenheim und Pastor Kehler, weißt du noch?“ Wendisch nickt.
„Mit dem habe ich oft über dich gesprochen. Oft. Und wenn Wendisch scheitert, habe ich ihn gefragt, kommt er dann wohl zurück?“
„Dora, wir gehen”, sagt die Redakteurin.
„Bitte”, sagt Fede, “tun Sie das. Es ist auch schon spät. Der Hund muß ins Bett. Und die wirklichen Geschichten von Sesenheim werden Sie nur langweilen. Sie sind ja noch nicht Literatur.”
Das Haar der Redakteurin ist noch um keine Spur trockener.
„Wie heißen Sie eigentlich?“
„Friederike Brion.“
„Ach Gott, Sie Ärmste. Und Sie leben auch noch in Sesenheim?“
„Und Sie? Haben Sie es weit bis nach Hause?“ Fede nimmt ihre Hand von Wendischs Arm. Die Rothaarige schaukelt auf dem Barhocker mit den Knien, und ihr Rock rutscht auf einer grünen Strickstrumpfhose höher.
„Erzählen Sie ruhig weiter, Fräulein Brion”, sagt die Redakteurin und in ihrer Stimme ist eine professionelle Müdigkeit wie bei einer zu langen Ansage, für die sie kein Geld bekommt. “Sie sind so frei, Fräulein Brion, wie alle vom Dorf. Sie werden sogar noch rot, wenn Sie erzählen.”
„Erzählen?” murmelt Wendisch. “Die erfindet doch.”
Fede zieht ein Taschentuch aus ihrem Rock. Irgendwie ist der Rock in den letzten Minuten länger geworden, und sie schneuzt sich. Daß ihr das jetzt bloß kein trauriges Taschentuch wird!
„Passen Sie kurz auf den Hund auf?“ fragt die Redakteurin. „Ich muß mal zur Toilette.“
Und Fede hofft, daß der böse Mann mit den Bartstoppeln noch auf dem Gang ist, wie vorhin, und daß er ihr gleich neben der Toilette etwas Böses antut.
„Wie heißt er?“
“Wer?”
“Der dich gefahren hat.”
„Clemens.“
„Und ist wie alt?“
„Jung.“
„Weiter?“
„Mehr ist nicht.“
„Da fehlt doch noch was?“
„Ja”, sagt sie. “ Aber das ist bei Sprache so, sonst gäbe es keine Wörter, nur Reihen.“ Bei dem Wort Reihen sieht sie vor sich die Reihen von Fahrradständern auf dem Schulhof, die Reihen von Kleiderhaken im Flur, und wie diese Haken im Rathausflur höher hängen als die im Schulflur. Da muß sie wieder hin.
„Wie ist er so?“
„Ja”, sagt sie langsam, “er hat ausdrucksvolle Hüften.” Eine Frau in einem weißen Popelinemantel geht an ihrem Tisch vorbei, und Fede lacht. “Wendisch, ich glaube, deine Bekannte kommt nicht mehr, und den Hund hat sie dir ans Bein gebunden.”
Während Wendisch irritiert an seiner Bügelfalte zieht, dreht sich die Frau im Popelinemantel um, so daß ihr Gesicht sich halbiert, halb im Licht, halb im Schatten liegt. Die Augen an dessen Saum. Die Frau verschwindet durch die Eingangstür. Der rote Vorhang gegen die Kälte schlägt hinter ihr zusammen und Fede sieht eine goldene Krone über die Holzdielen des Cafés rollen, über die die Frau soeben noch gegangen ist. Die Krone ist, was vom Verschwinden der Frau bleibt. Etwas, das man aufheben kann.
„Was will dieser Clemens von dir?“
„Er glaubt, daß ich schön bin. Bin ich aber gar nicht.“ Sie legt den Kopf in der Hand ab.
„Was sonst?“
„Ich tue nur so.”
Hinter dem Tisch in dem großen Spiegel sieht sie ein trauriges Café, da drüben in der Nacht. Die Gesichter lösen sich nackter als am Tag voneinander, wenn die Gespräche stocken. Manches ist schon ganz schief vor Müdigkeit. Was ist verloren? Mit den Jahren verloren? Die seelische Fähigkeit, sich Täuschungen zu überlassen? Noch immer den Blick im Spiegel, schaut sie erst sich in die Augen. Dann dem Kellner, der in der Arbeit inne hält. Der Kellner ist so alt wie Clemens. Er hat die halbe Orange in der Hand. Während sie sich anschauen, hält seine Hand auf halber Höhe in der Luft inne. Sie läßt den Blick in seinem stehen. Wo sich ihre Blicke schneiden, setzt sich eine dritte Person hin, genau auf die Schnittstelle. Mathilde. Das Bild friert ein.
„Ihr Orangensaft”, sagt der Kellner plötzlich dicht an ihrem Ohr. Er hat längst den Blick aus dem Spiegel genommen, ist zum Tisch gekommen und hat ein Glas vor sie hingestellt. Einen Moment lang irren ihre Augen allein über das Spiegelglas. Was für ein trauriges Café, dort drüben. Wo das wohl ist?
„Ich zahle, für alles”, sagt Wendisch, der sich tatsächlich verspricht. Oder kommt es ihr nur so vor?
Bei der Autobahnauffahrt nach Hagenau, denkt sie, wohnen hundert Spatzen im Gebüsch und teilen sich jede leere Coladose, die aus einem Autofenster fliegt. Ja, daran denkt Fede, während sie merkt, solange kann man gar nicht auf dem Klo sein. Auch als Blondine nicht. Solange kann man gar nicht sein Gesicht restaurieren.
„Und ihr Hund?“ fragt Fede.