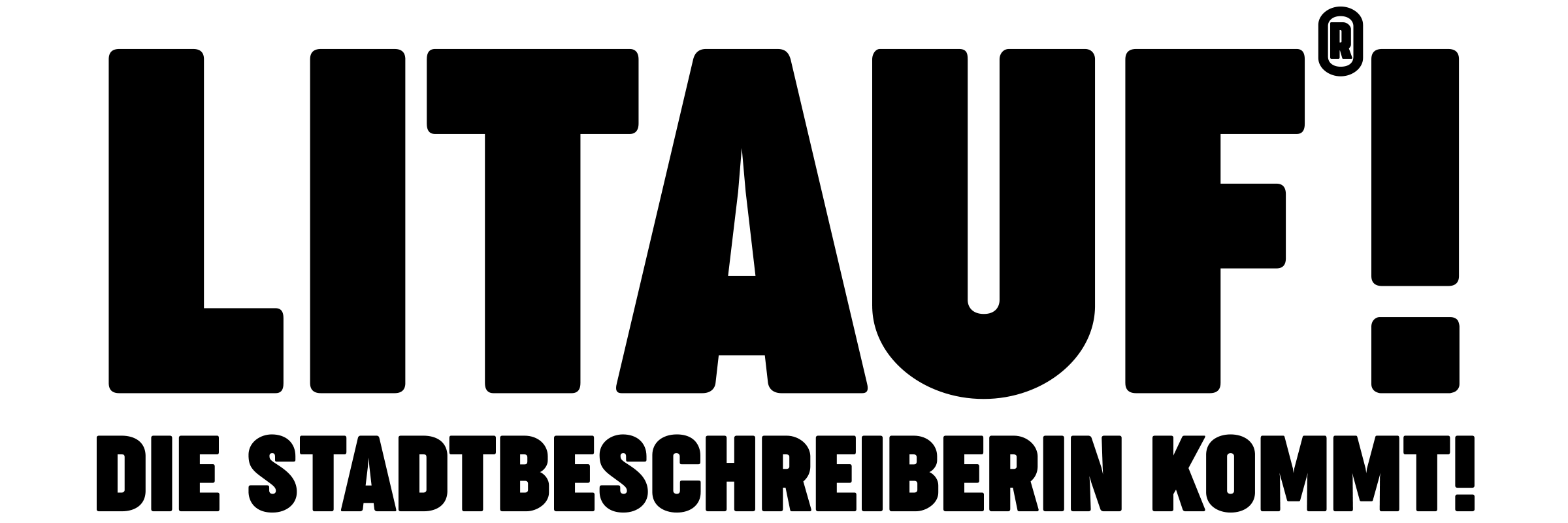AUS DER ZUCKERFABRIK
Dorothee Elmiger
Hanser Verlag 2020
Ist eine Lesende von einem Buch angetan und bleibt doch ratlos, drängen sich ihr Vergleiche mit früheren Leseerfahrungen auf. So geschehen bei der Lektüre von Dorothee Elmingers neuem Buch AUS DER ZUCKERFABRIK. Elmiger, geboren 1985 in Wetzikon bei Zürich, folgt den Spuren des Geldes und des Begehrens durch die Jahrhunderte, schreibt der Hanser Verlag in seiner Ankündigung. Sie entwirft Biographien von Mystikerinnen, Spielern und Kolonialisten, protokolliert Träume und Fälle von Ekstase und Wahnsinn, die die ratlos Lesende an „Physik der Schwermut“ des bulgarischen Autors Georgi Gospodinov oder an „Gestürzter Engel“ des Schweden Per Olof Enquist erinnern. Hier wie dort tun sich in knappen, kunstvoll ineinandergefügten Liebeskatastrophen erschriebene Welten und Zusammenhänge auf, die sich entzünden an gesammeltem Wissen und längst Erzähltem, an Erfahrungen, Begehren und einem unstillbaren Hunger nach Sinn. Nein, so entsteht kein Roman im üblichen Sinn, kommt keine spannende Fiktion zu Papier, sondern ein anderes Erzählgewebe nimmt gefangen. Nicht-Romane haben ihren eigenen Zauber, haben ihre eigene Erzählreihenfolge.
- „Wenn ich in einem leeren Hotelzimmer ankomme, möchte ich sofort etwas essen.“
- „Die Bäume vor Recklinghausen sind groß und stehen dicht an den Gleisen, die Unterseite ihrer Blätter leuchten silbern im warmen Oktoberlicht.“
- „Ich habe Hunger. Ich liebe dich.“
Wie muss man sich die Arbeitsweise dieser Schweizer Autorin vorstellen?
„Ich setze mich frühmorgens an den Tisch und tippe und lese, bis ich irgendwann nach dem Mittag aufgebe oder stecken bleibe,“ sagt sie in einem Interview.“ Die Nachmittage verbringe ich dann in einem sehr unzufriedenen Zustand und warte auf den nächsten Morgen. Wenn ich aber erst gerade anfange, einen Text zu schreiben, dann halte ich nur ab und zu einen Satz fest oder unterstreiche einen Absatz in einem Buch und lasse dann wieder viel Zeit verstreichen. Meist arbeite ich zuhause, manchmal in der Bibliothek…“
Wie verbinden sich in Elmigers Texten, die keine Romane sein wollen, das An-Gelesene und das Herbei-Geschriebene? Schreiben wird so eine Form von Leben und umgekehrt? Und auch die Frage drängt sich auf: Ist Schreiben besser als das Wagnis zu leben? Durch Elmigers Arbeitsweise entstehen in Momentaufnahmen, die nur schwerlich einen Halt im Moment davor und dem danach finden, unheimliche Mosaikwelten, die der ratlos Lesenden jene Welt, in der man morgens aufsteht und sein Marmeladenbrötchen isst, fremd werden lässt. Liebe und Hunger – so vermitteln de diese scharfkantigen Textgeschosse aus der Zuckerfabrik – gehören zusammen wie Biografisches und Bücher. Ja, und auch Menschen können einer Schreibenden wie Elmiger beim Fortgehen näher kommen. Das ist dann keine optische Täuschung, sondern ein literarisches Verfahren. „Ich sehe ihm nach, wie er sich auf dem hellen, staubigen Pfad vom Meer entfernt. Mit rudernden Armen steigt er steil aufwärts der gleißenden Sonne entgegen…“ Das ist der allerletzte Abschnitt in Elmingers Buch, der vielleicht an einem der ersten Vormittagen mit dem neuen Projekt ZUCKERFABRIK entstanden sein mag, um dann tapfer all die unzufriedenen Nachmittage danach bis zum Abschluss des Manuskripts zu überleben. Elmigers Schreibgesten sind oft nur wenige Atemzüge lang. Der Schnitt zur nächsten Episode, nächsten Einstellung oder zum nächsten Zitat scheint dem Rhythmus des Lidschlags zu folgen. Was sie sich erschreibt, soll nicht Vergangenes überliefern, sondern ein Ort des Gesprächs, oder ein Netz für ein plötzliches Wissen sein. In ihrem letzten Buch „Schlafgänger“ (noch erschienen bei DuMont) ging es bei Dorothee Elmiger um die Faszination des Fallens, um den Moment, wo der Fallende sich verliert und eine Ahnung davon bekommt, wie die Sache mit dem Tod sein könnte. Eben noch war er jemand, jetzt ist er niemand mehr. Ähnlich schlafgängerischen Fall-Figuren tauchen auch in diesem Buch AUS DER ZUCKERFABRIK auf, heißen Brinkmann, Kinski, Nijinsky, Kaschnitz, Madame Bovary. Elminger führt sie wie Zeugen dicht bei sich. Wir hören ihre Stimmen, die mit der Autorin gemeinsam sagen: Ja, es lässt sich am Schreiben gehen.