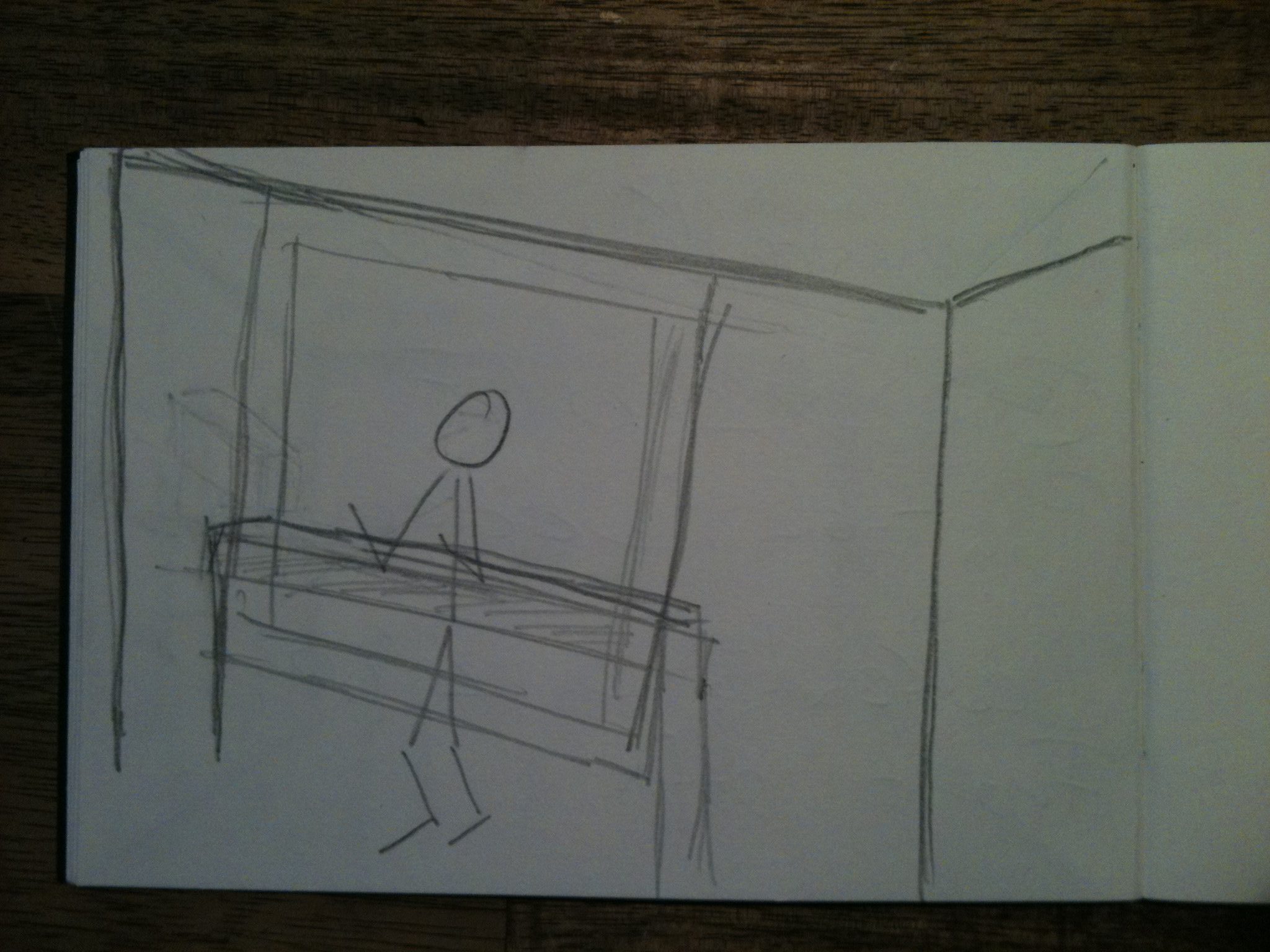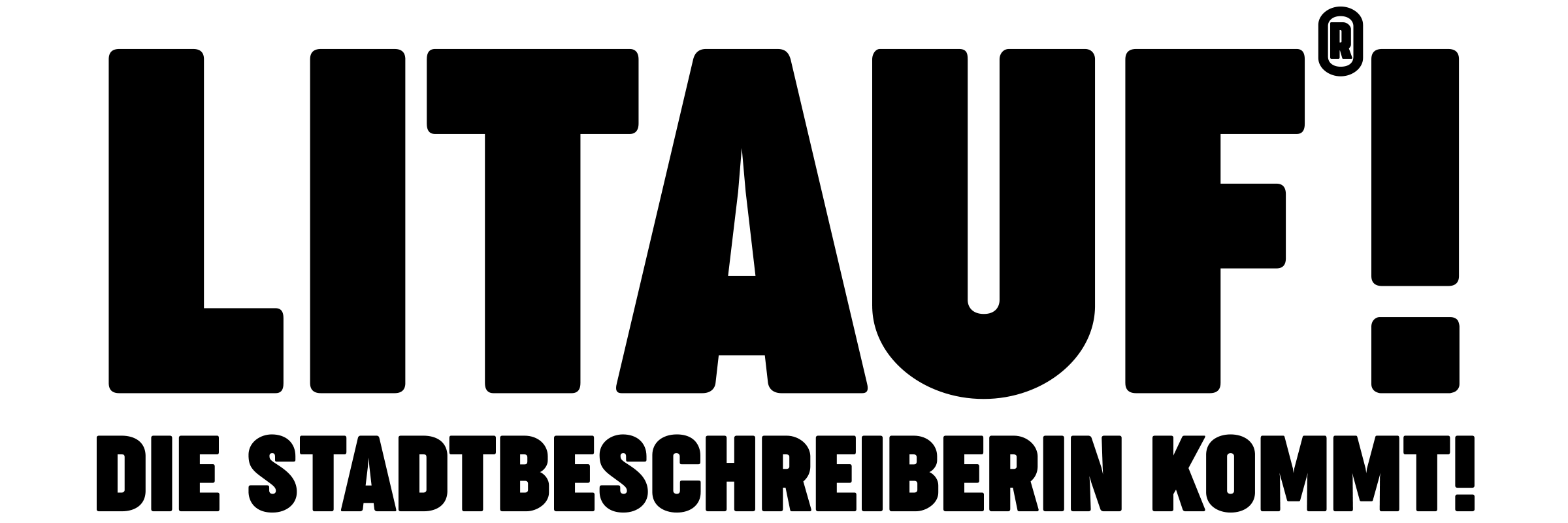Pastor Kehler und seine Frau haben Mathilde damals aufgenommen. Sie und ihren Papagei. Mathilde ist vor vier Jahren für ihr letztes Schuljahr aus dem Waisenhaus Colmar nach Sesenheim gekommen und Fedes Schülerin gewesen. Mathilde ist anders als die anderen Mädchen im Ort. Sie ist mehr als nur jung und sieht aus wie Marilyn Monroe, als die noch nicht Marilyn Monroe war. Mathilde klemmt ihre leberwurstfarbenen Haare mit zwei alten Wellenreitern von Frau Pastor hinter die Ohren und hat schiefe Zähne. Trotzdem. Wenn sie auf der Bank bei der Bushaltestelle sitzt und liest, fahren die Autos langsamer. Eines Tages ist Fede mit Clemens vorbei gefahren.
“Fahr mal langsamer”, hat Fede gesagt. “Da ist die Mathilde.”
“Welche Mathilde?”
Fede ist ausgestiegen. Clemens folgte. Mathilde schlug ihr Buch zu und stand von der Bank auf. Das kleine T-Shirt ließ ihren Bauch frei. Der Anblick hat Fede gestört. Denn ihr war, als sähe sie sich selbst im Rückspiegel eines vorbeifahrenden Autos auf der Dorfstraße stehen, plötzlich wieder siebzehn und wieder nur darauf wartend, daß das Leben endlich vorbei kommt. Sogar Farbe und Marke des Autos, das so ein Leben fährt, waren damals vorbestimmt. Ein silbergrauer Ford, in Fedes Fall. Der Ford von Wendisch. Von Wendisch, damals, vor fünfzehn Jahren.
Welche Farbe und Automarke Mathilde bevorzugt, hat Fede nicht gewusst. Sie hat aber energisch am Saum von Mathildes T-Shirt gezogen und den Stoff in den Bund der Jeans gestopft.
“Aber das trägt man so.”
“Aber hast du das nötig?”
Irgend etwas hat auf dem T-Shirt gestanden. Zicke? Vielleicht. Auf jeden Fall zeichneten sich Mathildes Brüste unter den fetten Buchstaben ab. Fede hat ihren Mantel zusammengeschlagen und gesehen, wie Clemens sich beide Frauen sehr genau ansah. Es ist mehr ein Reflex als eine absichtliche Geste gewesen, daß sie ihn da zum ersten Mal ins Gesicht faßte, auf offener Straße, mit zwei Fingern über seine Wange fuhr und Clemens deswegen erstaunt, erfreut, und dann ein wenig spöttisch sie angeschaut hat.
Das sei ihre ehemalige Schülerin Mathilde, hat Fede zu laut gesagt und ihren linken Handteller in Richtung des Mädchens geschoben. Als ob sie um etwas bäte. Und das sei Clemens. Sie hat die rechte Hand nach ihm ausgestreckt und dann beide Hände zueinander geführt und gemerkt, sie ist allein. Denn Clemens und Mathilde haben sich angeschaut in dem Moment, und der Moment dauerte und gehörte den beiden. Mathilde hat, während sich eine kleine Haarsträhne aus dem Wellenreiter losriß und auf ihrer Stirn nachzitterte, sehr ruhig gesagt: „Ich weiß, ich habe Sie schon oft gesehen. Sie fahren doch unter der Woche nach Straßburg in einem blauen Peugot? Sie fahren manchmal an mir vorbei.“
Fede hat die Hände in die Manteltaschen geschoben. Der Moment zwischen Mathilde und Clemens war einen Moment zu lang gewesen. Sie standen zu dritt auf der Straße. Es wurde langsam dunkel. Schon hat Fede die beiden herum spazieren sehen, bis hinunter zum Fluß, das Licht bräunlich, wie immer an späten Sommertagen. Er sicher schneller und schneller, um die anderen Spaziergänger abzuhängen. Um mit ihr und den zwei langen Schatten an ihren Fersen allein zu sein. Um später im Dunkeln ganz mit ihr allein zu sein, und das nicht nur, um Anfangsbuchstaben in Baumrinden zu ritzen. Fede hat die leere Straße hinunter geschaut. Ja, es wurde dunkel. Auch die Dämmerung ist so ein Prozeß, der sich nicht aufhalten läßt. Endlich ist Mathildes Bus gekommen.
„Wie findest du sie?“ hat Fede gefragt, als sie neben Clemens wieder im Auto saß.
„Es geht”, hat er gesagt. “Ich habe nicht so genau hingeschaut.”
„Ha”, sagt der Taxifahrer. Er nimmt mit links eine scharfe Kurve, dreht das Steuer ruckartig zurück, daß Fede kurz kippt und gleich wieder gerade sitzt.
„Säßen Sie vorn, wäre das eine schöne Komm-Kurve gewesen.”
„Sie hieß nicht Mathilde“, sagt Fede da zum Taxifahrer. „Sie hieß Friederike.“
„Kann sein, daß die so hieß. Aber auf jeden Fall war das diese Sache mit Goethe. Und die war in Sesenheim?“
„In Sesenheim, klar”, sagt sie. “Wo war Goethe nicht.“
Als Wendisch damals gegangen ist, hat das Gartentor gequietscht. Im Ort sagen die Frauen mit den Kopftüchern über Fede: Die Friederike, die wird gar nicht älter. Es stimmt. Sie ist wohl stecken geblieben mit ihrem Gesicht in dem Tag, an dem Wendisch ging. Der 1. September 1984. Seit dem Tag denkt sie immer, er kommt zurück. Immer wenn das Gartentor quietscht. Das ist ein Fehler, aber einer mit Hoffnung. Am Ende ist sie froh gewesen, in das Apartmenthaus am Ortsausgang von Sesenheim gezogen zu sein, in das Haus, wo Wendisch nie gewesen ist und wo nie ein Gartentor quietscht. Vor dem Haus liegt ein schmaler Streifen Rasen, auf dem die Anwohner vom Haus ihre Autos parken. Manchmal, wenn sie heim kommt und ein leichter Regen einsetzt, sieht sie das Haus, wie es ihr grau entgegen glänzt. Es ist ein noch junges, sechsstöckiges Gebäude, aus Beton, mit Balkonen wie Schießscharten, das Anfang der Achtziger Jahre in der Straße hinzugezogen ist. Die anderen Häuser mögen es nicht, und an Regentagen rücken sie noch weiter von ihm ab.
„Erzählen Sie ruhig”, sagt der Taxifahrer, “dann schlafe ich wenigstens nicht ein.”
„Ach”, sagt Fede, “meiner schreibt eben.“
„Glückwunsch, und was fährt er für ein Auto?”
“Einen Ford Transit. Silbergrau.”
“Ach so einer.”
„Wissen Sie”, sie senkt die Stimme. Der Raum wird davon dichter.
“Wissen Sie, diese Ford-Transit-Fahrer …” der Taxifahrer hat ebenfalls die Stimme gesenkt. Der Ton zwischen ihnen ist verschworen, obwohl sie aneinander vorbei reden.
“Er ist nach Sesenheim gekommen wie ein Ethnologe nach Afrika.”
Der Taxifahrer nickt, aber er lügt. Er hat sie gar nicht verstanden. Er mag nur, wie sie leise miteinander sprechen, als habe jemand eine Schlafdecke über sie gelegt. Dann hustet er trocken. Sie hat einen Fehler gemacht. Jetzt denkt er nicht mehr über sie nach, sondern über das Wort Ethnologe. Und plötzlich ist ihnen beiden langweilig wie im Theater. Auch sie fängt an zu husten, hebt das linke Handgelenk dicht vor die Augen und versucht, die Uhrzeit im Licht der vorbei huschenden Straßenlampen zu entziffern. Plötzlich sagt er:
“Und was wollte der wirklich in Sesenheim?”
“Suchen Sie etwas Bestimmtes”, hat auch der Bürgermeister von Sesenheim wenige Tage nach Wendischs Ankunft von ihm wissen wollen. Wendisch hat gezögert. Fede stand zufällig beim Umtrunk im Rathasu neben ihm und hat gedacht: Nimm mich!
Sie hat ihn am Tag zuvor schon gesehen und ihn sich ausgeschaut. Wendisch saß da am Eckfenster vom Croix d´Or, wo die Lüftung einem in den Nacken zieht. Er saß gebeugt und lauernd über einem Stück Papier und trank einen Ballon rouge. Es war früher Mittag. Er schrieb. Vom ersten Augenblick an dachte sie, er wolle ihr, so am Fenster hockend, ein Bild von sich geben. Nur ihr. Er sah zu spät auf, als sie nach der fünften Stunde Sport in ihren flachen Schuhen vorbei ging. Er heiße Wendisch, erfuhr sie vom Pastor noch am gleichen Tag.
Kennt man den?
Der Name sagte ihr nichts, obwohl sie Deutsch unterrichtete, und dieser Wendisch schrieb.
Novellen, sagte der Pastor, er schreibt Novellen.
Das ist vor fünfzehn Jahren gewesen, im letzten Frühling, bevor ihre Eltern starben, und sie aus dem Zuhause bei der Kirche in das Apartmenthaus am Dorfrand zog. Damals ist Wendisch über fünfzehn Jahre älter gewesen als sie, daran hat sich in den letzten fünfzehn Jahren wenig geändert. Nur sie hat sich verändert, in ländlicher Abfolge. Erst Schaf, eine unglückliche Zeit lang Ziege, und mit fast vierzig endlich Kuh. Bei Wendisch ist sie noch Schaf gewesen, ein junges Schaf auf flachen Schuhen. Sie hätte Stunden, Wochen, ein Leben lang auf dem Bett liegen und ihm beim Schreiben zusehen können, wenn er nur zwischendurch aufgestanden und mit oder ohne seine Tasse, mit oder ohne seine Zigarette, sein Glas Whisky, ja, mit oder ohne Oberhemd zu ihr ans Bett gekommen wäre, und gesagt hätte:Kleine, Schöne, meine Süße. Spatz, wie ich dich liebe. Und es am besten gleich auch getan hätte. Als Wendisch nach Sesenheim kam, um irgendwas zu recherchieren, ist er ein gerade noch junger Dichter gewesen, der ohne Feuer aber mit viel Verstand und noch mehr Lärm schrieb. Ein Sprachmeister, aber keiner, der begeisterte. So hat sie es in den Jahren danach ihren Schülern beigebracht. In den Jahren, in denen Wendisch berühmt wurde und sie allein in Sesenheim zurück blieb. Wendisch stand nicht auf dem offiziellen Lehrplan. Sie hat ihn aus Rache durchgenommen.
Wendisch und sie sind damals sehr vertraut miteinander geworden. Sie wußte, wann er gerülpst und sich deshalb und auch wo verschrieben hatte. Sie begann, in grüne Bettwäsche gewickelt und an seinen Rücken gelehnt, der Wendischs Schreibbewegung auf sie übertrug, blind die Verben in seinen Sätzen zu prüfen. Einem Satz ohne Verb fehle die Haltung, sagte sie. Er küßte sie dafür. Eines Tages ist Wendisch gegangen und kurz darauf richtig Wendisch geworden. Ein erfolgreicher angestrengter Romanautor mit Preisen, Frauen und Reisen und zwei oder drei Suchtproblemen. Die Frauen liebten ihn dafür, daß er die Frauen liebte. Und nun, ein Häufchen müder Glut, aber sentimental geworden, hat er ihr die Einladung zu seiner Lesung im Straßburger Opernfoyer geschickt. Er hat an ihre alte Adresse geschrieben. Sie hat am quietschenden Gartentor der Eltern gelehnt, als die Karte kam.
„Wissen Sie?” Sie legt die Stirn gegen das Seitenfenster. Kurz beleuchtet den Straßenrand ein blauer Neonelefant. Er wirbt mit erhobenem Rüssel für das nächste Einkaufszentrum. Der Rüssel will ein großes Lachen sein. Beim Anblick des leeren Parkplatzes vor dem flachen Verkaufsgebäude fällt Fede die Einsamkeit aller Sonntage in den Rücken, die sie allein in Sesenheim verbracht hat.
“Wissen Sie, in meiner Erinnerung hat er all die fünfzehn Jahre an seinem Auto gelehnt und ist neben dem Bahnwärterhaus in Sesenheim stehengeblieben, als hätte jemand ihn da für mich in Stein gehauen.“
Der Taxifahrer stützt den Ellbogen auf die Innenverkleidung.
“Der Ethnologe, meinen Sie”, sagt er und nimmt den Rücken seines Mittelfingers in den Mund. Ziemlich zärtlich, findet sie.
Sie wüßte gern, wie er heißt.
Daß sie aber auch nichts geahnt hat und Schulstunde hielt, während Wendisch an der kleinen Tankstelle am Ortsausgang einen Ölwechsel machen und die Luft in den Reifen prüfen ließ, sein Zimmer im Croix d´Or zahlte und ein Trinkgeld hinzu legte, das man nur zum Abschied da läßt, so daß die Frau des Organisten, die damals noch keine siebzehn war, zur Schule gelaufen kam, Fede, Fede flüsterte unter dem Fenster des Klassenzimmers, und zwei Mal: Achtung, Achtung, er geht!Es war um die dritte Schulstunde, vielleicht war es Deutsch, aber sicher ist es das Ende des Sommers gewesen.
In jener Nacht schliefen sie stundenlang miteinander, und sie sagte: nicht kommen, nicht kommen!Hat sie denn geglaubt, wer so am Kommen hindert, verhindert auch das Gehen? Hatte sie das geglaubt? Ja, sie erinnert sich.
Sie lehnt den Kopf gegen die Seitenscheibe des Taxis. Vereinzelte Autos reißen Lichtbänder über die Straße. In Sesenheim fährt um diese Zeit kein Auto mehr, und die Witwe vom Coop schnarcht bei geöffnetem Fenster auf die Straße hinunter.
Ja, so hätte es sein können: Draußen verglühen die Sommerabende und die Winter verschneien sich. Ein Mann wird nicht Wendisch, aber aus dem Wir wird etwas. Wer sagt denn, daß, wer keinen Erfolg hat, weniger wert ist? Er kann auch hier schreiben, dachte sie damals, kann schreiben und bleiben, während sie, von Montag bis Sonnabend auf flachen Schuhen im Sommer und in Gummistiefel im Winter zur Arbeit geht, einkauft, sich mittags zu ihm legt, davon bestimmt rasch ein Kind bekommt, und er und sie die Jahre wie Vögel vorüber fliegen lassen.
“Träumen Sie?” fragt der Taxifahrer. „Wie alt sind Sie eigentlich?“
Als sie Achtunddreißig sagt, pfeift er anerkennend. Sie überhört das.
„Manchmal“, sagt sie, “wenn ich Schnee schaufele am Gartentor, die Büsche im Vorgarten meiner Eltern ab Dezember schneide, heruntergewehte Äste vom Gehsteig sammle, im Kittel, seit zwei Jahren trage ich Kittel …”
„… den müssen Sie aber schnell ausziehen, wenn das Gartentor mal richtig quietscht“, sagt der Taxifahrer und zieht hart an seiner Zigarette.
„… wenn ich die Dachrinne am Haus, wo ich einmal mit meinen Eltern gewohnt habe, putze und im Hof die Birnen auf den Kies klatschen, denke ich: Er ist tot.”
Dann holt sie Luft.
“Ach Scheiße, die Liebe!”
„Was wäre Ihnen denn lieber?“ fragt er.
Plötzlich hat sie einen Schluckauf.
„Fahren Sie schneller”, sagt sie.
In jener letzten Nacht sind Möwen an der Moder gewesen. Es hat geregnet. Wenn sie es bislang nicht gewußt hatte, von da an wußte sie es. Man schläft nicht miteinander, um noch mehr miteinander zu sein, sondern um sich voneinander losreißen zu können. Der Rhythmus macht, daß es geht. Während er wohl dachte, so käme er gut weg, dachte sie, er bleibt, er bleibt! Bei dem Regen bleibt er sicher. Und später einmal werden wir nur noch von dem Regen sprechen. Werden sagen: Erinnerst du dich noch an den Regen, der dann fiel? Sie ist danach vom Bett aufgestanden. Sie hat sich gedehnt. Der Tag war trüb. Ich muß nach Frankfurt, hat K gesagt. Fede sah Frankfurt gleich vor sich. Hohe Häuser, und dazwischen ein kleiner gelber Kirchturm, der den anderen Häusern nur bis zur Hüfte reicht. Da mußte er nicht hin! Doch, hat er gesagt. Denn eigentlich wollte er nur kurz hier schreiben, dann mußte er bleiben. Das hat er ihr übel genommen, vor allem bei schlechtem Wetter. Sie hat sich wieder gedehnt, gelacht, gesagt, das sei schon ganz anderen hier so gegangen. Und er hat auf den Bettpfosten geschlagen. Das Karussell in Frankfurt fahre jetzt ohne ihn weiter, hat er gesagt. Welches Karussell, hat sie gefragt, denn von seinem Nebenverdienst auf der Kirmes wußte sie noch nichts. Sie hat im Lachen noch angefangen zu denken, und ihr Gesicht wird wohl plötzlich scharf geworden sein. Klar, auf dem Karussell saß die Konkurrenz, schlief nicht. Auch nicht mit ihr, dem Mädchen von der Moder. Die Konkurrenz schrieb um die Wette. Sie hat Wendisch angesehen. Aber mit mir …, hat sie gesagt. Mit ihr fand Wendisch lauter schöne Sätze, am Wegrand, auf den Spaziergängen, über’s Land oder hinunter zum Fluß. Die Sätze hat er nicht aufgeschrieben. Aber die waren es, worauf er schrieb. Die haben sie gemeinsam übereinander geschichtet, aber schweigend. Und sie freihändiger als er.
Aber mit mir …, hat sie noch mal gesagt und ihn im Stehen vor dem Bett eine Stunde lang geküßt.
In dem Kuß ist schon die Erinnerung an den Kuß gewesen.
„Schauen Sie mal“, sagt der Taxifahrer. „Der Himmel.“ Er bremst. „Das ist ja ein Feuerwerk.”
„Das sind die Leoniden“, sagt sie und steigt schon aus.
Er nimmt sie bei der Hand. So gehen sie auf ein freies Feld hinaus. Sie hat noch immer den Schluckauf.
„Ein Wunder”, sagt er.
„Das kommt alle dreiunddreißig Jahre so, das Wunder”, sagt sie. „Es kommt von einem eisigen Gesteinsblock, der im Abstand von zwölf Millionen Kilometern an der Erde vorbei rauscht. Er verliert Tausende von Staubkörnern. Die verglühen.“
„Haben wir ein Glück”, sagt der Taxifahrer und zündet sich eine Zigarette an, ohne ihre Hand loszulassen. Das hat Routine, vom vielen Fahren? Vom Rumstehen auf nächtlichen Felder mit vielen Frauen?
„Wünschen Sie sich etwas”, sagt sie und versucht den Schluckauf zu unterdrücken.
„Aber das sind ja Tausende.“
„Dann eben tausend kleine …“
„Wünsche? Sie unterschätzen mich“, sagt er. „Und Sie?“
„Ich wünsche mir zwei Jahre Sex, fünf Jahre Liebe, fünfzehn Jahre Freundschaft.“
„Das ist …“
„Nicht klein“, sagt sie, „sondern realistisch.“
„Und mit wem? Mit dem in dem blauen Peugot, der abfuhr, kurz bevor ich anhielt, oder mit Ihrem Ford-Transit-Fahrer, der eh schon in Ihrer Erinnerung silbergrau an jeder Ecke herumsteht? Wenigstens den Wagen sollten Sie mal verschrotten.“
Sie fährt sich mit der Hand durch das Haar, dann durch das Gesicht. Der Schmelz von früher ist weg, sagt ihr der Handteller deutlicher als jeder Spiegel. Sie schaut zum Himmel und ist plötzlich unsäglich müde. Und zugleich hat sie Angst vor diesem Schauspiel um das Nichtsein, da oben. Stünde nicht ein Mann mit dem Geruch nach Mann auf diesem freien Feld neben ihr, sie wäre dem ausgeliefert, was hinter ihr steht. Und das ist groß und ewig und ohne Farbe, wie nur das Nichts sein kann.
„Wenn die Leoniden das nächste Mal so wild vorbei stürzen, bin ich tot”, sagt sie.
„Wann haben Sie gemerkt, daß dieser Ford-Transit-Fahrer Sie nicht mehr richtig liebt?“
Tod ist kein Thema für Taxifahrer, aber vielleicht schaut ihr Schutzengel so aus wie er.
„Er hat mich immer häufiger Radfahren geschickt”, sagt Fede und geht langsam zum Taxi zurück.
Als sie einsteigen, fragt sie:
„Woran glauben Sie?“
„An das, was ich sehe.“
Er dreht sich auf dem Fahrersitz um. Sie hält die Luft an. So wird sie wenigstens den Schluckauf los.
„Was sehen Sie?“
„Sie sehen gut aus.“ Während sie flüstern, bewölkt sich der Himmel.
„Und was ist aus Wendisch geworden?“
„Nachdem er gefahren ist?“
„Ja.“
„Wendisch eben.“
„Berühmt?“
„Ja.“
„Wie Goethe?“
„Nein.“
„Und er hat Sie nach Frankfurt eingeladen?“
„Nein, nicht nach Frankfurt. Nach Straßburg.“
„Sofort?“
„Nein, fünfzehn Jahre später.”
“Nach so langer Zeit?”
“Ja, und ich bin wegen dem Mann sogar zum Friseur gegangen”, sagt sie, “weil ich mich eigentlich ganz nach vorn setzten wollte. Das Fernsehen war da, und eine Journalistin hat den Kameramann ein paar mal auf das Wasserglas unter der Leselampe hingewiesen, in dem Rotwein war, und als das Team den letzen Scheinwerfer am Ende der Lesung noch nicht ganz ausgeschaltet hatte, ist diese Redakteurin nach vorn gegangen und ganz nah an ihn heran getreten. So wie manche Frauen das machen, so mit dem Becken, Sie verstehen? Sie hatte auch einen tiefen Ausschnitt im Pullover und er hat tief hinein geschaut. Wissen Sie, da kann ich ihm auch nicht helfen, wenn er nicht merkt, daß so ein Ausschnitt nur eine Ausschnitt ist und nicht die ganze Person. Wer da hinein fällt, dem kann man nicht helfen, oder? Ich aber bin in meiner zweiten Reihe einfach nur aufgestanden und habe den oberen Knopf am Mantel geöffnet. Da hat er mich angesehen.”
„Und”, fragt der Taxifahrer, “ hat er Sie erkannt?”
“Ich weiß es nicht”, sagt sie leise. “Ich weiß es nicht. Ich bin ja nicht so eindrücklich auf den ersten Blick.”
“Oh, oh”, sagt er, “ das finde ich schon.”
Sie sind schon nah bei der Stadt, der Himmel, auf den sie zufahren, wird heller. Sie fahren durch einen Tunnel, der nicht beleuchtet ist. In regelmäßigen Abständen fällt Nachtlicht von außen in die schwarze Röhre ein. Grau-schwarz-grau-schwarz wechseln sich ab, als hörte das nie auf.
„Es macht Spaß, mit Ihnen in der Nacht zu fahren.“
„Ach ja?“ sagt sie müde.
„Fede in der Nacht”, sagt er. Sie erinnert sich nicht, ihm ihren Namen gesagt zu haben. „Weshalb fahren Sie jetzt noch nach Straßburg zurück, Fede?“
„Um ein Buch zu kaufen.“
Er bremst, dreht sich zu ihr um.
“Um diese Zeit?”
“Ja.”
“Von diesem Wendisch?” Er schiebt den Kopf zwischen den Vordersitzen durch und schiebt das Kinn in ihre Richtung.
“Um diese Zeit?” fragt er noch mal. Sein Mund kommt näher und küßt sie nicht.
“Hat das nicht Zeit bis morgen?”